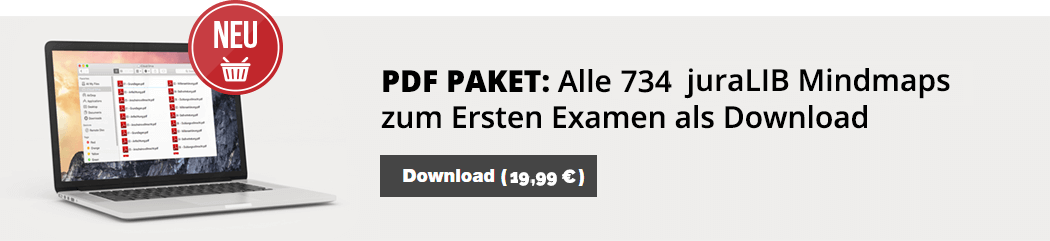Bundesgerichtshof
Entscheidung vom 06.06.1952, Az.: 1 STR 708/51
Tenor
Auf die Revisionen der Angeklagten K. und Da. wird das Urteil des Landgerichts in Heilbronn vom 2. August 1951 samt den Feststellungen aufgehoben, soweit die Angeklagten verurteilt sind. In diesem Umfang wird die Sache zur neuen Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Rechtsmittel, zurückverwiesen, und zwar an das Landgericht in Stuttgart.
Entscheidungsgründe
1.Den Angeklagten wird vorgeworfen, als Verwalter und Erzieher im Landheim L. der Inneren Mission in mehreren Fällen Fürsorgezöglinge misshandelt zu haben. Sie sind nach den §§ 223, 223 a, 223 b StGB verurteilt. Das Urteil bringt zum Ausdruck, dass die Angeklagten Züchtigungen teils ohne Grund, teils unter Überschreitung ihres Züchtigungsrechtes vorgenommen und dass sie sich auch nicht in einem beachtlichen Irrtum über ihre Befugnis zum Züchtigen befunden hätten. Dazu ist zu bemerken:
Das Züchtigungsrecht stand den Angeklagten in demselben Umfange wie den Eltern der Zöglinge und den Schulbehörden zu (§ 66 der württ. AusfVO vom 19. März 1928 zum LandesjugendwohlfahrtsG vom 23. November 1927, RegBl 1928 S 23). Insoweit ist dem Landgericht beizutreten. Dagegen sind die Fragen eines Irrtums über den Anlass zum Züchtigen im Einzelfalle oder einer irrtümlichen Überschreitung der Züchtigungsbefugnis in gewissen Fällen noch nicht erschöpfend geprüft. Dies wird nachzuholen sein, und zwar nunmehr unter Beachtung der im Beschluss des BGH GSSt 2/51 vom 18. März 1952 (JZ 52, 335) aufgestellten Grundsätze. Danach hängt die Bestrafung der Angeklagten wegen Körperverletzung zunächst davon ab, inwieweit sie in jedem einzelnen Falle den Sachverhalt richtig erkannt und demgemäss den Tatbestand vorsätzlich oder auch fahrlässig verwirklicht haben, und sodann von der Frage, ob sie das Bewusstsein hatten, Unrecht, nämlich etwas Unerlaubtes zu tun, oder dieses Bewusstsein bei gehöriger Sorgfalt und Gewissensanspannung jedenfalls haben konnten, wobei die äusserste Grenze jedes Züchtigungsrechts im Sittengesetz liegt (RGSt 73, 258).
a)In den Fällen, in denen mangels einer Verfehlung des Zöglings überhaupt kein Grund für die Ausübung des Züchtigungsrechts bestand, die Angeklagten oder einer von ihnen eine solche Verfehlung in tatsächlicher Beziehung aber irrig angenommen haben, wie möglicherweise im Falle Gr./Kö., wären sie einem Irrtum über den Sachverhalt erlegen und hätten daraus ein nur vermeintliches Züchtigungsrecht entnommen. Insoweit wären sie wegen eines für ihre Vorstellung und ihr Verhalten grundlegenden Tatirrtums zu einem unrichtigen rechtlichen Schluss über ihre Züchtigungsbefugnis gelangt. Dass ein solcher Irrtum über einen Rechtfertigungsgrund auf der Grundlage eines Tatirrtums entsprechend § 59 StGB als Tatirrtum und nicht als Verbotsirrtum zu behandeln ist, hat der Beschluss des Grossen Senats zwar nicht ausdrücklich ausgesprochen. Er hat aber die Gründe dargelegt, die für dieses Ergebnis sprechen. Zwar ist der Täterwille auch beim Tatirrtum auf die Zufügung körperlicher Schmerzen, gerichtet; aber dieser Wille, im Sinne von Vorsatz, beruht bei aller fallweise möglichen Abstufung im wesentlichen nicht auf Verkennung rechtlicher Grundsätze oder gar auf einem mehr oder weniger bewussten Hinwegsetzen über Rechtsschranken. Der im Irrtum über den wahren Sachverhalt handelnde Täter ist vielmehr an sich rechtstreu; er will die Rechtsgebote befolgen und verfehlt dieses Ziel nur wegen seines Irrtums über die Sachlage, aus der sein Handeln erwächst. Dieser Irrtum hindert ihn in der Regel, die Gefahr eines Rechtsverstosses überhaupt zu erkennen. Deshalb trifft auf ihn der Gedanke des § 59 StGB zu, ihm nicht die wirkliche, sondern zu seinen Gunsten nur die irrig angenommene Sachlage zuzurechnen. Zwar ist auf dem Gebiet der Rechtfertigungsgründe die Unterscheidung zwischen dem nur Tatsächlichen und einem rechtlichen Schluss aus Tatsachen mitunter schwierig, aber doch nicht in der Weise, dass es sich rechtfertigen liesse, diese Fälle, die dem Tatirrtum regelmässig weit näher stehen als dem blossen Verbotsirrtum, nicht auch als Tatirrtum zu behandeln.
Auch der im Verbotsirrtum Handelnde verfehlt zwar bei seinem Tun das objektiv Richtige, aber durch einen Erkenntnisfehler auf dem Gebiet des rechtlichen Sollens. Die Erkennbarkeit eines Rechtsverstosses liegt hier im allgemeinen naher als beim Irrtum über Tatsachen. Beide Irrtumsarten können Einzelfalle gleicherweise vermeidbare gleicherweise mehr oder weniger fahrlässig und beide auch mehr oder weniger vorwerfbar sein. Gleichwohl wird der im Irrtum über den Sachverhalt Handelnde in der Regel den geringeren Schuldvorwurf verdienen. Ein solcher Irrtum ist regelmässig stärker und unmittelbarer und ein stärkerer Anreiz zum Handeln. Er versetzt den Täter nicht, wie meist der Verbotsirrtum, in einen tathemmenden Zwiespalt zwischen Wollen und Dürfen, den er erst überwinden muss, sondern drängt ihn zum Handeln oder lässt ihn jedenfalls ohne Rechtsbedenken und sittliche Hemmungen handeln. Ist hiernach ein Irrtum über den Sachverhalt auch dann allgemein nach § 59 StGB zu behandeln, wenn er die Grundlage des Irrtums über einen Rechtfertigungsgrund bildet, so ist für den gegebenen Fall nach § 59 StGB die Folge, dass insoweit vorsätzliche Körperverletzung ausschiede, aber bei Vermeidbarkeit des Tatirrtums fahrlässige Begehung anzunehmen wäre.
b)Wo dagegen die Angeklagten die Sachlage richtig dahin erkannt hatten, dass die gesetzlich zulässige Züchtigung wegen einer Verfehlung des Zöglings angebracht sei, ab er wegen irriger Vorstellungen über Art und Umfang ihres Züchtigungsrechts dieses überschritten haben, ist ihr Irrtum als Verbotsirrtum zu behandeln. Hier ist zu prüfen, ob die Angeklagten erkannt haben oder jedenfalls nach Vorbildung. Stellung, Berufserfahrung und den gesamten Umständen hätten erkennen können, dass sie ihr Züchtigungsrecht überschritten (BGH JZ 52, 335). Im einzelnen ist das Tatfrage. Schläge mit einem Schlüsselbund ins Gesicht oder sinnloses, unbeherrschtes Prügeln - falls dies festgestellt wird - konnten die Angeklagten als erfahrene Erzieher bei gehöriger Überlegung nicht für erlaubt halten; ein solches Vorgehen missachtet die Persönlichkeit des Bestraften, nimmt dem Erzieher die sittliche Überlegenheit und ist deshalb keine gerechte Erziehungs- und Strafmassnahme. Bei Schlägen mit der flachen Hand, unter besonderen Umständen vielleicht auch einmal mit der Faust, wird es darauf ankommen, inwieweit die sofortige Züchtigung unumgänglich und etwa in anderer Weise nicht angängig war. Wo ein Verbotsirrtum nach gerichtlicher Überzeugung vermeidbar war, ist Bestrafung nicht nur wegen fahrlässiger, sondern wegen vorsätzlicher Körperverletzung zulässig.
c)In gewissen Fällen könnte freilich zu einem Tatirrtum im erörterten Sinne ein Verbotsirrtum mit der Folge irrigen oder unüberlegten Missbrauchs des auf Grund des Tatirrtums beanspruchten Züchtigungsrechts hinzugetreten sein (Fall Gr./Kö.). Der Angeklagte hätte dann zweifach geirrt, einerseits in tatsächlicher Beziehung über die vermeintliche Verfehlung des Zöglings, andererseits rechtlich darüber, wie weit er beim vermeintlich zulässigen Züchtigen nach Art und Umfang gehen dürfe. Ein solcher doppelter Irrtum wäre nach den dargelegten Grundsätzen nach beiden Richtungen auf seine strafrechtlichen Folgen zu prüfen, zunächst hinsichtlich der Tatbestandsverwirklichung, und wenn er hier nicht zur Straflosigkeit führt, hinsichtlich des Unrechtsbewusstseins.
2.Angeklagter K.
a)Der Zögling Se. hatte das Heim verbotswidrig verlassen und war mit einem fremden Motorrad zu seiner Mutter gefahren. Fach anfänglichem Leugnen gestand er dies ein. Der jetzt 59jährige, seit Jahrzehnten als Erzieher tätige Angeklagte schlug ihn daraufhin in grosser Erregung mit einem Gummischlauch wahllos über Rücken, Nacken und Kopf und traf ihn auch am verletzten Ellbogen, was Se. erhebliche Schmerzen verursachte. Das Landgericht geht bei seinen Erörterungen zu diesem Fall nicht genügend auf die für den Tatbestand des § 223 a StGB unentbehrliche Frage ein, ob hier "ein Werkzeug nach seiner objektiven Beschaffenheit und der Art seiner Benützung zu einem gefährlichen gemacht" worden ist. Derartiges ist an sich möglich; ob es auf einen massig starken Weinschlauch zutrifft, dessen Wirkung das Landgericht an anderer Stelle der des als Züchtigungsmittel üblichen Rohrstocks gleichsetzt, ist auch bei ungezielten Schlägen nicht ohne weiteres ersichtlich. Vom Standpunkt des § 223 a aus wird ein solcher Schlauch - anders als ein Gummiknüppel - nur unter bestimmten Umständen ein "gefährliches" Werkzeug sein, etwa bei Schlagen gegen besonders verletzliche oder empfindliche Organe und Körperteile. Insoweit wäre nähere Begründung, insbesondere zur Frage des Vorsatzes erforderlich gewesen.
b)Das Landgericht nimmt an, K. habe den Zögling Se. mit bedingtem Vorsatz gerade am verletzten Ellbogen treffen wollen. Es stellt ein Handeln in grosser Erregung, eine "sinnlose Schlägerei" von seiner Seite fest, zugleich aber, K. habe trotz dieser die ruhige Überlegung weit gehend ausschliessenden Erregung damit "rechnen müssen", gerade den Ellbogen zu treffen. Angesichts dessen bedurfte es besonderer Begründung und vor allem eines ausdrücklichen Ausspruches, dass der Angeklagte, wie beim bedingten Vorsatz erforderlich, mit der Verletzung des erkrankten Ellbogens auch wirklich gerechnet und diesen Erfolg gebilligt ha. Das verstand sich trotz seines unbeherrschten Vorgehens nicht von selbst.
c)Auch die Anwendung des § 223 b StGB ist unzulänglich begründet und lässt das hier nötige Eingehen auf die gesamten Tatumstände vermissen. Das Merkmal des "rohen" Handelns und damit einer gefühllosen, fremde Leiden missachtenden Gesinnung - die keine dauernde Eigenschaft des Täters zu sein braucht - steht im § 223 b dem bewussten Quälen und der böswilligen Vernachlässigung der Fürsorgepflicht gleich. Ein Handeln in grosser Erregung wird für sich allein selbst bei einer äusserlich schweren Tat nicht auf rohes Misshandeln hindeuten, solange die Erregung und nicht zugleich eine gefühllose Gesinnung die Triebfeder der Misshandlung ist. Das Landgericht sieht zwar im Vorgehen des Angeklagten K. den Ausdruck gefühlloser Gesinnung. Dabei lässt es aber seine weiteren Feststellungen ausser acht, die kaum daran zweifeln lassen, dass das Gesamtverhalten des Angeklagten K. gegenüber dem Zögling Se. vor und nach der Tat in hohem Maße durch einen bisher unaufgeklärten Erregungszustand beeinflusst gewesen ist, der durch schwere Ungehörigkeiten "des Zöglings noch gesteigert worden war und auch nach der Tat zu einer harten, vom Landgericht nicht beanstandeten Züchtigung geführt hat. Für die Anwendbarkeit des § 223 b ist es nicht massgebend, ob der Angeklagte als Erzieher irgendwann versagt und sich vielleicht sogar ungerecht verhalten hat. Die Frage rohen Misshandelns setzt bei der Art der Züchtigung, die eher einem Ausbruch angestauter Erregung ähnelt, das Eingehen auf die Persönlichkeit des Angeklagten und des Zöglings, den Züchtigungsanlass und die besonderen Verhältnisse im Heim voraus. Nach dem Urteil sind dort besonders schwer erziehbare Jugendliche untergebracht. Der Angeklagte K. hatte sich mit unzulänglichen Kitteln und unzureichenden Arbeitskräften der umfangreichen Landwirtschaft des Heims und zugleich den Erziehungsaufgaben zu widmen. Das Landgericht nimmt an, dass ihn dies überlastet haben mag. Ferner ergeben die Urteilsfeststellungen, dass Diebstähle, Schlägereien, Aufsässigkeiten erheblicherer Art und (Fall Ec.) selbst erpressungsähnliche Handlungen unter den Zöglingen vorkamen, denen der Angeklagte unter den schwierigen Erziehungsverhältnissen nachdrücklich zu begegnen hatte. Es steht fest, dass er sein Züchtigungsrecht sonst massvoll ausgeübt hat. Über seinen allgemeinen Ruf als Erzieher und sein Verhalten während der langen Berufstätigkeit äussert sich das Urteil nicht, obwohl daraus wertvoller Aufschluss über die Gründe seines Verhaltens zu gewinnen gewesen wäre, Der Sachverhalt bedarf somit der weiteren Aufklärung und Prüfung.
d)Dasselbe gilt für die Fälle Gr. und Ec. Beide Zöglinge hat der Angeklagte K. "wahllos", ungezielt mit der Paust auf Kopf und Rücken geschlagen, Ec. auch ins Gesicht. Auch hier hält das Landgericht den Angeklagten starke Erregung zugute. Deshalb hätte es abgesehen von den schon erörterten Rechtsbedenken den für die Handlungen gegenüber Gr. angenommenen Fortsetzungszusammenhang näher begründen müssen. Die Wendung, es sei "durchaus möglich", dass der Angeklagte sieh vorgenommen habe, seiner Erregung "bei nächster Gelegenheit stattzugeben", bezeichnet nicht nur einen sehr unwahrscheinlichen inneren Vorgang; vor allem reicht die Annahme einer blossen Möglichkeit zur Begründung der inneren Tatseite einer fortgesetzten Tat nicht aus. Das Urteil stellt nicht sicher, dass die Annahme sich nur zu Gunsten des Angeklagten ausgewirkt hat.
Bei Ec. dessen erpresserisches Verhalten gegenüber dem Mitzögling Hä. verwerflich und strafwürdig war, sind zudem die Feststellungen über die angebliche seelische Wirkung der Misshandlung auf Ec. und damit über die etwaige Tatschwere unklar und widerspruchsvoll. Einerseits wird in der Form einer Feststellung gesagt. Ec. sei so verstört gewesen, dass er aus dem Fenster springen wollte, andererseits wird das dahin eingeschränkt, dass "jedenfalls andere Zöglinge dies dem Erzieher C. mitgeteilt" Mitten und der Angeklagte es nicht ernst nahm.
3.Angeklagter Da.
Mit Recht rügt die Revision mangelnde Altersangaben bei den Zöglingen Fe. und Kl., so dass das Revisionsgericht - wie auch schon in den dem Angeklagten K. zur Last gelegten Fällen - die Anwendung des Rechtsbegriffs "Jugendlicher" in § 223 b nicht nachprüfen kam. Ein Jugendlicher in diesem Sinne ist nur, wer noch nicht das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die Anstaltseinweisung hat darauf keinen Einfluss. Hatten beide Zöglinge das 18. Lebensjahr zur Tatzeit vollendet, wie die Revision vorbringt, so ist der § 223 b schon deshalb unanwendbar.
Im übrigen gelten auch hier die eingangs erörterten Grundsätze. Bedenkenfrei wäre bisher nur die Anwendung des § 223 a im Falle Kl., soweit ein Schlüsselbund zum Schlagen benutzt ist.
4.Strafmindernd hat das Landgericht bei beiden Angeklagten erwogen, sie seien in Anschauungen über das Züchtigungsrecht ausgebildet und gross geworden, die von denjenigen seit 1945 erheblich abweichen. "Ihre alte Ansicht" sei ihnen in Fleisch und Blut übergegangen; in der kurzen Zeit seit 1945 hätten sie nicht genügend von ihr loskommen können. Was die Strafbemessung betrifft, so beschwert diese unbegründete Ansicht die Angeklagten nicht. Sie kann aber auch die Schuldsprüche beeinflusst haben, so dass sie hier zu erörtern ist. Für die grundsätzlichen Auffassungen zu Erziehungsfragen, vor allem über die Zulässigkeit und Notwendigkeit körperlicher Züchtigung unter Anstaltsverhältnissen ist nicht ersichtlich, dass das Jahr 1945 einen Wandel gebracht hat, dem sich die Angeklagten hätten verschliessen können. Selbst die vom Landgericht herangezogene gesetzliche Regelung des Züchtigungsrechts stammt schon aus dem Jahre 1928 und kennzeichnet keine für die damaligen. Verhältnisse grundsätzliche Wandlung der Auffassungen. Ein immer stärkeres Zurücktreten der körperlichen Züchtigung im Schulwesen und überhaupt in der Erziehung ist in den letzten Jahrzehnten unverkennbar. Die veränderten Anschauungen hierüber machen ihren Einfluss aber schon seit Jahrzehnten geltend und sind an den Angeklagten insgesamt schwerlich vorübergegangen. Es ist nicht auszuschliessen, dass die Unklarheiten hierüber auch zu Ungunsten der Angeklagten die Beurteilung der besonders schwierigen Verhältnisse beeinträchtigt haben, unter denen sie arbeiteten und die sie zwangen, sich gegenüber den entwicklungsgefährdeten Jugendlichen zu deren eigenem Wohl nachdrücklich durchzusetzen, wenn der ohnedies ungewisse Erziehungserfolg nicht ganz in Frage gestellt werden sollte.
Der Senat hat von der Verweisungsmöglichkeit an ein benachbartes Landgericht Gebrauch gemacht (§ 354 Abs. 2 StPO).