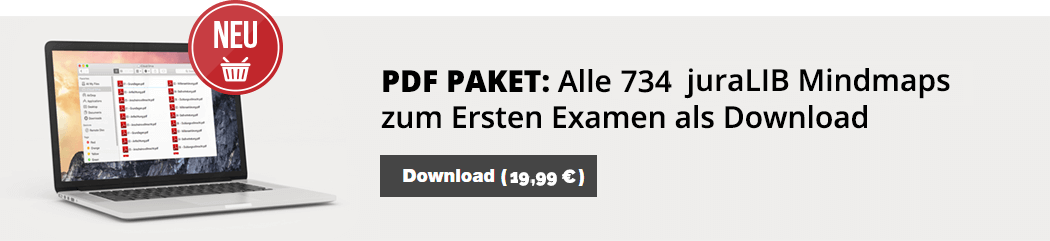Bundesgerichtshof
Entscheidung vom 02.02.1993, Az.: 1 StR 849/92
Entscheidungsgründe
Das Landgericht hat den Angeklagten wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeuges, wegen Urkundenfälschung in zwei Fällen, wegen Betrugs in sechs Fällen, davon in zwei Fällen tateinheitlich mit Urkundenfälschung und Kreditkartenmißbrauch, wegen Kreditkartenmißbrauchs und wegen versuchten Betrugs zu einer Gesamtfreiheitsstrafe verurteilt. Gegen dieses Urteil hat der Angeklagte fristgerecht Revision eingelegt und diese mit der Sachrüge begründet. Das Rechtsmittel hat keinen Erfolg.
1.Entgegen dem Vorbringen des Beschwerdeführers hat das Landgericht zu Recht zwischen den einzelnen Straftaten keinen Fortsetzungszusammenhang angenommen. Aus den Feststellungen des Urteils ergeben sich keine Anhaltspunkte für einen alle Taten umfassenden Gesamtvorsatz. Ein solcher Gesamtvorsatz lag nach Sachlage auch fern; der enge zeitliche Zusammenhang der Taten und die finanzielle Notlage des Angeklagten allein ändern daran nichts.
2.Der Schuldspruch wegen unbefugten Gebrauchs eines Kraftfahrzeugs unterliegt keinen rechtlichen Bedenken (vgl. BGHSt 11, 47, 50; BGH GA 1963, 344); daß der Angeklagte zum - weiteren - Gebrauch des Fahrzeugs nicht befugt war, wußte er (UA S. 14).
3.Auch die Verurteilungen wegen Betrugs in Tateinheit mit Kreditkartenmißbrauch und Urkundenfälschung (Fälle II, 3, 4) halten der rechtlichen Nachprüfung stand.
Nach den Feststellungen hatte der Angeklagte in diesen Fällen unter dem Namen und den Personalien anderer Personen jeweils Kreditkarten (Euro- und Visakarte; Citybank-Visakarte) erlangt, wobei er von vornherein die Absicht hatte, die Karten mißbräuchlich zu verwenden und die ihm zur Verfügung gestellten Beträge nicht zurückzuerstatten. Unter Verwendung der Euro- und Visakarte erlangte er Waren und Dienstleistungen im Wert von 25.299,95 DM, mit der Citybank-Visakarte tätigte er Barabhebungen von 2.150 DM.
Die Erlangung der Kreditkarten unter Vorspiegelung falscher Tatsachen und Verwendung unrichtiger Personalien hat das Landgericht rechtsfehlerfrei als Betrug in Tateinheit mit Urkundenfälschung gewürdigt (vgl. BGHSt 33, 244, 245). Die Aushändigung der Kreditkarten an den zahlungsunfähigen und zahlungsunwilligen Angeklagten stellte bereits eine Vermögensgefährdung der Kreditkartenfirmen dar (vgl. BGH a.a.O. S. 246; Lenckner in Schönke/Schröder, StGB 24. Aufl. § 266 b Rdn. 14; a.A. Ranft JuS 1988, 673, 680, der eine schadensgleiche Vermögensgefährdung verneint).
Zutreffend hat das Landgericht weiter im Falle II 3 angenommen, daß der Angeklagte durch den Gebrauch der Kreditkarte die ihm durch deren Überlassung eingeräumte Möglichkeit, den Aussteller zu einer Zahlung zu veranlassen mißbraucht und dadurch den Tatbestand des § 266 b Abs. 1 StGB erfüllt hat. Ob das allerdings auch für den Fall II 4 gilt, in dem der Angeklagte Barabhebungen getätigt hat, oder ob nicht in diesem Falle nach § 263 a StGB zu bestrafen ist, ist im Schrifttum außerordentlich umstritten (vgl. die Darstellungen bei: Cramer in Schönke/Schröder a.a.O. § 263 a Rdn. 11; Dreher/Tröndle, StGB 45. Aufl. § 263 a Rdn. 8 a, § 266 b Rdn. 1, 1 b; Bernsau, Der Scheck- und Kreditkartenmißbrauch durch den berechtigten Karteninhaber, 1990, S. 134 ff.) und in der Rechtsprechung noch nicht abschließend geklärt (vgl. OLG Stuttgart NJW 1988, 981 [OLG Stuttgart 23.11.1987 - 3 Ss 389/87], das für den Mißbrauch einer Euroscheckkarte § 266 b StGB annimmt). Doch bedarf die Rechtsfrage hier keiner Entscheidung, denn der Angeklagte ist dadurch, daß er auch im Falle II 4 nach der milderen Vorschrift des § 266 b StGB verurteilt worden ist, nicht beschwert.
§ 266 b StGB ist entgegen einer im Schrifttum vertretenen Ansicht (Lenckner in Schönke/Schröder a.a.O. § 266 b Rdn. 14; Schlüchter, 2. WiKG S. 117; Küpper NStZ 1988, 60, 61) bei der hier gegebenen Fallgestaltung auch nicht bloß mitbestrafe Nachtat gegenüber § 263 StGB. Zur Begründung dieser Rechtsmeinung wird darauf hingewiesen, daß hier der Täter die Nachtat begehen muß, wenn die Vortat einen Sinn haben soll (Küpper aaO). Jedoch führt erst der Gebrauch der Kreditkarte über die zunächst eingetretene Vermögensgefährdung hinaus zur Konkretisierung und Vertiefung des Schadens.
Daneben ist hervorzuheben, daß § 266 b StGBüber das Vermögen hinaus auch die Funktionsfähigkeit des bargeldlosen Zahlungsverkehrs schützt; dieser wird erst tangiert mit der mißbräuchlichen Benutzung der Kreditkarte (Bernsau a.a.O. S. 132; vgl. auch Lenckner in Schönke/Schröder a.a.O. § 266 b Rdn. 1).
Ob bei der danach gegebenen Anwendbarkeit des § 266 b StGB im Verhältnis zu § 263 StGB in den hier zu entscheidenden Fällen Tateinheit oder Tatmehrheit besteht, ist gleichfalls umstritten (für Tatmehrheit Bernsau a.a.O. S. 133; für Tateinheit Dreher/Tröndle a.a.O. § 266 b Rdn. 9 m.w.Nachw.), doch bedarf auch diese Frage keiner Entscheidung, denn der Angeklagte ist durch die Annahme von Tateinheit nicht beschwert.
Auch im übrigen hat die Überprüfung des Urteils keine Rechtsfehler zum Nachteil des Angeklagten ergeben.