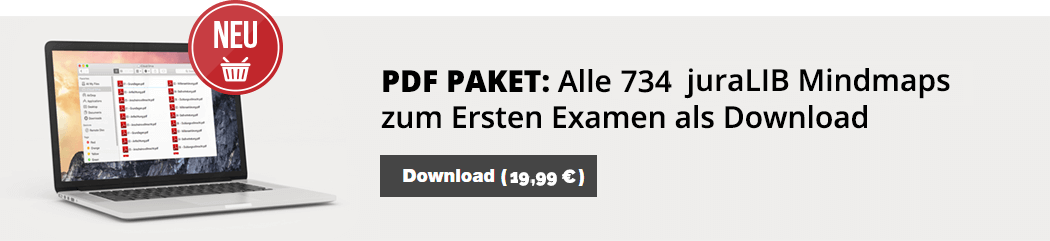Bundesgerichtshof
Entscheidung vom 25.02.1959, Az.: V ZR 176/57
Tenor
Die Revision gegen das Urteil des 1. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Köln vom 19. September 1957 wird auf Kosten der Klägerin zurückgewiesen mit der Maßgabe, daß die Feststellungsklage als unzulässig abgewiesen wird, soweit sie künftige Schutzbrücken betrifft.
Von Rechts wegen
Tatbestand
Die Klägerin fördert in eigener Grube im Tagebau eine bestimmte Tonart (Klebsand). Der gewonnene Ton wird von einer Drahtseilbahn der Klägerin über verschiedene, im Gemeindegebiet der Beklagten belegene und zum Teil dieser gehörige Grundstücke dem Fabrikationsbetrieb der Klägerin zugeführt und zur Herstellung feuerfester Erzeugnisse verwandt. Der Betrieb der Seilbahn ist durch Dienstbarkeiten (Drahtseilbahn-Gerechtsame) dinglich gesichert, die zugunsten der Klägerin in den Grundbüchern der betroffenen Grundstücke eingetragen sind (vgl. Grundakten des Amtsgerichts in Siegburg von Spich Gemeinde Sieglar Band 24 Blatt 933, Abt. II lfd. Nr. 3 und 12 des Grundbuchs).
Die Drahtseilbahn wurde um die Jahrhundertwende von der Rechtsvorgängerin der Klägerin, der Firma P. C.- und D. werke GmbH in Sp., errichtet. Sie führte damals über Acker- und Ödland, überquerte jedoch bereits die Provinzialstraße Nr. 1 (die heutige Bundesstraße 8) sowie die Eisenbahnlinie K.-T. An den Übergangsstellen über den beiden Verkehrswegen baute die Rechtsvorgängerin der Klägerin Brücken zum Schütze gegen herabfallenden Ton. Zur Errichtung und Unterhaltung der über der Straße angebrachten Schutzbrücke hatte sie sich durch schriftliche Erklärung vom 5. Oktober 1900 gegenüber der Provinzialverwaltung in Düsseldorf verpflichtet (Hülle Bl. 36 GA Anl. 1).
In den Jahren 1952/53 baute die Beklagte im Rahmen eines Besiedlungsplanes in einem von der Seilbahn überquerten, bis dahin ungenutzten Gebiet auf eigenen Grundstücken die Straßen "Im Rosengarten" und "Freiheitsstraße", die nach der von der Beklagten nicht bestrittenen Behauptung der Klägerin Gemeindewege darstellen (Bl. 5, 16, 21 GA). Auf Veranlassung des Bergamts Köln II in Bonn, das mit der Betriebsschließung drohte, errichtete die Klägerin auch über den neuen Straßen zwei Schutzbrücken. Die Baukosten betrugen 5.362,26 DM.
In der Folgezeit versuchte die Klägerin, von der Beklagten sowohl unmittelbar als auch über das Oberbergamt in Bonn eine Erstattung ihrer Aufwendungen zu erreichen. Die Beklagte lehnte eine Übernahme der Kosten ab. Das Oberbergamt teilte der Klägerin mit, daß ihm die Festsetzung einer Entschädigung nach bergrechtlichen Vorschriften verwehrt sei und der Klägerin anheimgestellt werde, einen etwaigen Anspruch gegebenenfalls im ordentlichen Rechtswege geltend zu machen.
Die Klägerin meint, die Beklagte sei ihr sowohl vertraglich als auch gesetzlich zur Kostentragung und zur Unterhaltung der beiden neu angelegten sowie aller weiteren Schutzbrücken verpflichtet, deren Errichtung durch den Bau weiterer Straßen notwendig werden könne.
Sie hat beantragt,1.die Beklagte zur Zahlung von 5.362,26 DM nebst 7 1/2 % Zinsen seit dem 9. April 1954 an die Klägerin zu verurteilen,2.festzustellen, daß die Beklagte verpflichtet sei, die Schutzbrücken "Im Rosengarten" und "Freiheitsstraße" in ordnungsmäßigem und sauberen Zustande zu halten sowie die Kosten für alle Schutzbrücken und deren Unterhaltung zu tragen, die infolge der Aufschließung und Besiedlung des Gebietes der Beklagten noch errichtet werden sollten.
Die Beklagte hat um Abweisung der Klage gebeten.
Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, das Oberlandesgericht hat die Berufung der Klägerin zurückgewiesen.
Mit der Revision verfolgt die Klägerin die Klageanträge weiter. Die Beklagte bittet um Zurückweisung des Rechtsmittels.
Entscheidungsgründe
A.Zahlungsanspruch.
I.Soweit der Zahlungsanspruch auf öffentlich-rechtliche Grundlagen gestützt ist, haben ihn die Vorinstanzen zutreffend verneint. Das gilt sowohl für § 5 des Gesetzes über Kreuzungen von Eisenbahnen und Straßen vom 4. Juli 1939 (RGBl. I 1211) als auch für § 154 des Preußischen Allgemeinen Berggesetzes, ferner für § 70 des Preußischen Polizeiverwaltungsgesetzes vom 1. Juni 1931 (PrPVG) und für einen Anspruch aus Enteignung oder Aufopferung. Die Revision erhebt insoweit auch keine Einwendungen. Ergänzend ist zu bemerken:
Was den Entschädigungsanspruch aus § 70 PrPVG anlangt, so handelt es sich um den polizeimäßigen Zustand der Seilbahnanlage der Klägerin, nicht um den der Straßen der Beklagten. Die Gefahr, daß Menschen oder Sachen durch herabfallendes Beförderungsgut zu Schaden kommen, geht von der Seilbahn, nicht von den Straßen aus. Daran wird nichts geändert durch die zeitliche Priorität der Seilbahnerrichtung gegenüber dem Straßenbau und den Umstand, daß die Beschaffenheit der Seilbahnanlage bis zur Straßenanlegung nicht zu beanstanden war (vgl. Urteil des III. Zivilsenats vom 5. März 1953, LM Nr. 3 zu § 70 PrPVG unter Nr. 6; PrOVG 65, 369 f; Drews, Preußisches Polizeirecht II 1936 S. 70/72; zweifelnd W. Jollinek, Verwaltungsrecht 3. Aufl. S. 443). Zudem weist das Berufungsurteil (S. 11/12) mit Recht darauf hin, daß die genannte Gefährdungsmöglichkeit im vorliegenden Fall (anders als in dem vom Preußischen Oberverwaltungsgericht entschiedenen) dem Seilbahnbetrieb sogar bereits von Anfang an anhaftete und nicht erst durch den Bau der Straßen entstand; es kann zwar unterstellt werden, daß die Gefahrenmöglichkeit den zum Einschreiten erforderlichen Mindestgrad von Wahrscheinlichkeit (Jellinek a.a.O. S. 437) nicht hatte, solange die Grundstücke der Beklagten Ödland waren, vielmehr ihn erst erhielt, als die Beklagte die Straßen anlegte; auch das ändert aber nichts daran, daß die Polizeiwidrigkeit im Zustand der Seilbahn liegt. Hierfür ist nach § 20 Abs. 1 PrPVG die Klägerin als Eigentümerin verantwortlich; § 20 Abs. 3 kommt nicht zum Zug, da gerade nicht der polizeimäßige Zustand der öffentlichen Straßen der Beklagten, sondern der der privaten Seilbahn der Klägerin in Frage steht. Die bergamtlichen Aufforderungen - deren Charakter als Polizeiverfügung unterstellt werden mag - richteten sich deshalb an den Störer im polizeirechtlichen Sinne; ein Fall des § 21 und daher des § 70 PrPVG liegt also nicht vor. Es ist auch keine öffentlich-rechtliche Sonderregelung ersichtlich, die die Verantwortung des Eigentümers für den polizeimäßigen Zustand seiner Sache ausschlösse (vgl. PrOVG a.a.O. 376). Darauf, ob polizeiliche Maßnahmen auch gegenüber der Beklagten als Verursacherin zulässig gewesen wären, kommt es in diesem Zusammenhang nicht an.
Der Entschädigungsanspruch der Klägerin aus Enteignung oder Aufopferung (Art. 14 GG; §§ 74, 75 Einl. ALR) scheitert daran, daß sie zur Errichtung und Unterhaltung der umstrittenen Schutzbrücken auf ihre eigenen Kosten bereits auf Grund der sozialen Bindung ihres Eigentums und ihrer Dienstbarkeit verpflichtet ist (siehe unten) und aus diesem Grunde ein besonderes Opfer und damit eine öffentlich-rechtliche Entschädigungspflicht unter dem genannten Gesichtspunkt entfällt.
II.Der einzige Angriff der Revision richtet sich gegen die Verneinung des Klageanspruchs unter dem privatrechtlichen Gesichtspunkt des Dienstbarkeitsrechts.
In dieser Hinsicht führt das Berufungsurteil aus (S. 7/8): Eine Beeinträchtigung der Dienstbarkeit der Klägerin im Sinne der §§ 1090, 1027, 1004 BGB liege nicht vor. In technischer Hinsicht sei der Bahnbetrieb der Klägerin nicht behindert durch die vom Straßenbau verursachte Notwendigkeit der Brückenerrichtung; diese Notwendigkeit sei Ausfluß der der Klägerin hinsichtlich der Seilbahn schon bisher obliegenden Verkehrssicherungspflicht, die durch den Straßenbau nur eine konkrete Erweiterung erfahren habe. Auch eine mittelbare, wirtschaftliche Beeinträchtigung im Sinne von § 1027 BGB sei nicht gegeben, gleichgültig, ob durch die geforderten Anlagen die Rentabilität des Betriebs der Klägerin wesentlich berührt würde; denn die Dienstbarkeit der Beklagten habe nur eine Duldung (der Grundstücksbenutzung durch die Klägerin), nicht eine Unterlassung (der eigenen Grundstücksbenutzung) zum Inhalt. Es liege auch keine Änderung einer Anlage im Interesse des Eigentümers statt des Gläubigers vor, die etwa nach dem Rechtsgedanken des § 1023 BGB für die Klägerin unzumutbar sein könnte; denn die Beklagte habe auf die Dienstbarkeit der Klägerin bei der Bauplanung angemessen Rücksicht genommen; der Brückenbau sei auch weder von ihr verlangt worden noch in erster Linie in ihrem Interesse gelegen, vielmehr überwiegend im eigenen Interesse der Klägerin.
Dem Berufungsurteil ist für den Zahlungsanspruch jedenfalls im Ergebnis beizutreten.
1.Für diese Instanz ist zugunsten der Klägerin davon auszugehen, daß ihr an denjenigen Grundstücken, auf denen sich die Seilbahn und die beiden neuen Straßen kreuzen und deshalb die fraglichen beiden Schutzbrücken angebracht wurden, eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit des Inhalts zusteht, daß die Grundstückseigentümerin (Beklagte) die bestehende Anlage der Drahtseilbahn zu dulden und ihre Erhaltung und Erneuerung zu gestatten hat, wobei die Klägerin verpflichtet ist, der Beklagten den durch die Anlagen sowie ihre Unterhaltung und Erneuerung entstehenden Schaden zu ersetzen (vgl. wegen dieses Inhalts des Rechts die genannten Grundbucheintragungen).
2.Das Berufungsgericht verneint eine Beeinträchtigung der Dienstbarkeit durch die Beklagte schon deshalb, weil die Veränderungen der Anlage der Klägerin (Anbringung der neuen Schutzbrücken) nicht im Interesse der Beklagten, sondern jedenfalls überwiegend im eigenen Interesse der Klägerin erfolgt seien. Diese Annahme beruht auf rechtsirrigen Erwägungen. Die Schutzbrücken dienen, wie nach dem unstreitigen Sachverhalt zu unterstellen, ausschließlich dem Schutz des von der Beklagten eröffneten und in erster Linie, wenn nicht ausschließlich der Verbindung innerhalb der beklagten Gemeinde dienenden Straßenverkehrs und damit dem Interesse der beklagten Gemeinde. Dafür, daß die Klägerin irgendwelche betrieblichen oder sonstigen besonderen Vorteile von den Schutzbrücken oder auch nur von den neugebauten Straßen hätte sind weder Anhaltspunkte noch auch nur dahingehende Behauptungen der Beklagten ersichtlich; daß die Klägerin mit dem Brückenbau eine öffentlich-rechtliche Pflicht erfüllte, begründet noch kein Interesse in dem hier maßgebenden Sinn. Daß nicht die Beklagte, sondern die Polizeibehörde die Anbringung der Schutzbrücken ausdrücklich verlangte, ist nicht entscheidend; insbesondere wird dadurch weder ein eigenes Interesse der Klägerin an den Schutzbrücken begründet noch das Interesse der Beklagten daran beseitigt. Baß die Beklagte ihre Straßenbauplanung auf die bereits angelegte Seilbahn einrichtete und insofern auf sie angemessen Rücksicht nahm, stellt das Berufungsurteil zwar ohne Widerspruch der Revision fest; damit ist aber die Frage nach dem inhaltlichen Umfang der Dienstbarkeit der Klägerin und damit nach dem Vorliegen einer Beeinträchtigung durch die Beklagte entgegen der Annahme des Berufungsgerichts noch keineswegs unproblematisch zu ungunsten der Klägerin entschieden. Diese Entscheidung hängt vielmehr von weiteren Erwägungen ab, die in den Vorinstanzen nicht angestellt worden sind.
3.Eine Dienstbarkeit, sei es Grunddienstbarkeit oder, wie hier, beschränkte persönliche Dienstbarkeit, gewähre ihrem Wesen nach dem Berechtigten das Recht auf inhaltlich begrenzte Nutzung des belasteten Grundstücks und erlegt dem Eigentümer dieses Grundstücks (Belasteten) ein Dulden oder Unterlassen auf (§§ 1018, 1090 BGB). Pflichten zu einem positiven Tun obliegen primär weder dem Berechtigten noch dem Belasteten. Sie können jedoch für jeden von beiden als Nebenpflichten vorhanden sein; das ergibt sich beim Berechtigten aus seiner allgemeinen Pflicht zur schonenden Rechtsausübung (§ 1020 BGB, siehe unten), beim Belasteten aus den gesetzlichen Sonderbestimmungen des § 1021 (Pflicht zur Unterhaltung einer Anlage kraft Vereinbarung), des § 1022 (ebenso kraft Gesetzes) und des § 1023 BGB (Pflicht zur Tragung der durch Verlegung der Anlage des Berechtigten entstehenden Kosten). Dabei handelt es sich nicht um gesetzliche Schuldverhältnisse, die neben der Dienstbarkeit stehen, sondern um die Abgrenzung der Dienstbarkeit selbst (Wolff/Raiser, Sachenrecht 10. Bearb. § 106 zu Fußnote 38). Umstritten, aber ohne praktische Bedeutung ist die Frage, ob dadurch die Dienstbarkeit nur der Ausübung oder - wie wohl richtig - dem Inhalt nach beschränkt wird (Wolff/Raiser a.a.O. § 107 Fußnote 3). Derartige Nebenpflichten, auch zu einem positiven Tun, sind auch über den genannten, im Gesetz ausdrücklich geregelten Umfang hinaus möglich. So kann durch Vereinbarung dem Belasteten als Nebenpflicht in entsprechender Anwendung des § 1021 BGB jede positive Tätigkeit auferlegt werden, die zur Erhaltung seines Grundstücks in einen der Dienstbarkeit entsprechenden Zustand erforderlich ist (KGJ 41, 228; Wolff/Raiser a.a.O. § 106 zu Fußnote 42).
Der Umfang der Dienstbarkeit in diesem Sinne kann sich auch nachträglich ändern infolge Veränderung der Verhältnisse, sei es auf seiten des Berechtigten oder des Belasteten. So wird mit Recht eine nachträgliche Einengung des Umfangs (der Ausübung) der Dienstbarkeit infolge einer tatsächlichen Veränderung auf dem belasteten Grundstück dann bejaht, wenn sie für den Belasteten Bedürfnis ist, für den Berechtigten aber keine oder nur eine geringe Unbequemlichkeit oder Erschwerung verursacht (vgl. RG JW 1902 Beil. 249: Badebetrieb auf dem mit einer Fischereigerechtigkeit belasteten Grundstück - Tatfrage -; RG Warn. 1908 Nr. 479 = Recht 1908 Nr. 2184, bei etwas abweichender Terminologie: Verschließung des bisher unverschlossenen Wegs - Tatfrage -; RG Recht 1919 Nr. 68: Lagerung von Material auf dem mit einem Wegerecht belasteten Grundstück, soweit dieses zur Ausübung des Rechts nicht benötigt wird). Umgekehrt wird, weil für den Dienstbarkeitsumfang das jeweilige Bedürfnis des Berechtigten (herrschenden Grundstücks) maßgebend ist, durch dessen nachträgliche Bedürfnissteigerung der Dienstbarkeitsumfang erweitert, sofern sich die Steigerung in den Grenzen einer der Art nach gleichbleibenden Benutzung des dienenden Grundstucks hält und nicht auf eine unvorhersehbare, willkürliche Änderung in der Benutzung des herrschenden Grundstücks zurückzuführen ist (Senatsurteil V ZR 133/57 vom 21. Januar 1959: Kraftfahrzeugdurchfahrt bei einem Wegerecht aus einer Zeit, wo an derartigen Verkehr noch nicht zu denken war).
Alle diese Grenzziehungen beruhen auf einer Abwägung der einander gegenüberstehenden Interessen und letztlich auf dem das ganze Rechtsgebiet beherrschenden Grundsatz von Treu und Glauben (§ 242 BGB). So sieht die heutige Lehre mit Recht in § 1023 BGB einen besonderen Anwendungsfall der Schonpflicht aus § 1020 und in dieser wiederum einen Anwendungsfall des § 242 (Westermann, Sachenrecht 3. Aufl. § 122 IV 3; Wolff/Raiser a.a.O. § 108 zu Fußnote 6). Im Nachbarrecht ist als Ausfluß jenes allgemeinen Prinzips die Pflicht zur gegenseitigen Rücksichtnahme über die gesetzliche Einzelnormierung hinaus bereits weitgehend anerkannt (BGHZ 28, 110, 114 ff mit Nachweisen). Sie muß grundsätzlich auch für das insoweit dem Nachbarrecht nahe verwandte Gebiet der Dienstbarkeiten bejaht werden (vgl. in dieser Richtung andeutend das genannte Senatsurteil V ZR 133/57 vom 21. Januar 1959, ferner RGZ 169, 180, 183). Infolgedessen ist zu prüfen, ob sich nicht aus dem Grundgebot der gegenseitigen Rücksichtnahme, mit oder ohne Anlehnung an eine gesetzliche Einzelnorm, Nebenpflichten der einen oder anderen Partei ergeben, aus denen die Begründetheit oder Unbegründetheit des Klaganspruchs folgt.
4.Was zunächst den ursprünglichen Umfang der Dienstbarkeit anlangt, so konnten ihn die Parteien bei Begründung der Dienstbarkeit grundsätzlich selbst bestimmen. Bei einer Dienstbarkeit wie hier, die durch Hoheitsakt im Weg des Umlegungsverfahrens auf neue Grundstücke gelegt worden ist, gilt der alte Inhalt weiter (§ 20 des Preußischen Gesetzes über die Umlegung von Grundstücken - Umlegungsordnung - vom 21. September 1920, GS 453; vgl. §§ 54, 68 der Reichsumlegungsordnung vom 16. Juni 1937, RGBl I 629 und neuerdings §§ 49, 68 des Flurbereinigungsgesetzes vom 14. Juli 1953, BGBl. I 591). Dabei kommt es, soweit keine eindeutige Vereinbarung ausdrücklich getroffen ist, für die Auslegung, wie bei allen dinglichen Verträgen, nicht auf den seinerzeitigen Willen der ursprünglichen Vertragsschließenden an, sondern darauf, was jeder gegenwärtige oder künftige Beteiligte auf Grund der Bestellungsurkunde als Geschäftsinhalt annehmen muß (RG LZ 1917, 917; Seuff-Arch 79 Nr. 117; RGZ 131, 158, 168; Wolff/Raiser a.a.O. § 38 zu Fußnote 17; anders Westermann § 76 I 2). Das Berufungsgericht stellt in tatsächlicher Hinsicht fest, daß mit Ausnahme eines Vertrags von 1900 für die Überquerung der jetzigen Bundesstraße 8 vertragliche Abmachungen über Schutzbrücken und ihre Kosten zwischen den Parteien - womit ersichtlich auch die seinerzeitigen Vertragsparteien gemeint sind - nicht dargetan sind. Diese Feststellung wird von der Revision nicht bekämpft, ein Rechtsirrtum ist nicht zu erkennen.
Da hiernach ein Parteiwille zum fraglichen Punkt nicht festgestellt ist, muß geprüft werden, ob sich aus Treu und Glauben (§ 242 BGB) von vornherein eine Pflicht der Klägerin bzw. ihrer Rechtsvorgängerin ergab, etwaige künftige Schutzbrücken nach Art der jetzigen auf ihre (der Klägerin) eigenen Kosten zu erstellen, oder eine Pflicht der Beklagten zur Kostentragung, gegebenenfalls in welchem Umfang. Daß Pflichten zu positivem Tun als Nebenpflichten mit dem Recht aus einer Dienstbarkeit verbunden sein können, wurde bereits hervorgehoben. So ist in der Rechtsprechung anerkannt die Pflicht des Viehtreibberechtigten zur alsbaldigen Beseitigung des Unrats seiner Herde (OLG 18, 147, Hamm); das Gesetz selbst kennt eine Pflicht des Dienstbarkeitsberechtigten zur Unterhaltung einer Anlage (§ 1020 Satz 2 BGB) und unter Umständen auch zu ihrer Verlegung, allerdings auf Kosten des Belasteten (§ 1023). Eine Pflicht des Dienstbarkeitsberechtigten zur Neuerrichtung von Anlagen, und zwar auf seine eigenen Kosten, ist allerdings im Gesetz nicht ausdrücklich vorgesehen. Sie ergibt sich aber im vorliegenden Fall nach § 242 BGB aus der Gefährlichkeit, die dem Seilbahnbetrieb der Klägerin seiner Natur nach innewohnt. Die Ausübung einer Dienstbarkeit der vorliegenden Art bringt stets eine Gefährdung der dienenden Grundstücke durch die Möglichkeit des Herabfallens von Gegenständen mit sich. Diese Gefährdung mag solange, als die Grundstücke Ödland sind, noch keine Schutzvorrichtungen erfordern; solche Vorrichtungen werden jedoch in dem Zeitpunkt notwendig, in dem die Grundstücke dem Betreten durch Menschen oder Tiers in nicht ganz unbedeutendem Umfang erschlossen werden. Treu und Glauben gebieten hier im Regelfalle nicht etwa dem Belasteten, die Erschließung seines Geländes zu unterlassen, sonden dem Berechtigten, seine Seilbahn mit den durch die Erschließung nötig werdenden Sicherheitsvorrichtungen zu verschen, und zwar auf eigene Kosten. Mit der Möglichkeit einer solchen Erschließung in irgendeiner Art war in Westdeutschland angesichts der seit Jahrzehnten bestehenden und allgemein bekannten Raumenge schon um die Jahrhundertwende und erst recht später als keineswegs völlig unwahrscheinlich im Regelfalle zu rechnen; daß dies für die hier in Betracht kommenden Grundstücke ausnahmsweise nicht zuträfe, hat das Berufungsgericht nicht festgestellt, ein Revisionsangriff ist insoweit nicht erhoben. Auch sonstige Gründe, die der Sicherungspflicht der Klägerin im genannten Umfang ausnahmsweise entgegenstehen können, wie z.B. wirtschaftliche Unzumutbarkeit der (alleinigen) Kostentragung, sind nicht festgestellt, auch nicht substantiiert behauptet.
Hiernach war die Klägerin gegenüber der Beklagten nach dem Inhalt der Dienstbarkeit zur Errichtung der beiden Schutzbrücken "Im Rosengarten" und "Freiheitsstraße" auf eigene Kosten verpflichtet. Eine Beeinträchtigung der Dienstbarkeit im Sinne von §§ 1090, 1027, 1004 BGB liegt nicht vor; ein Kostenerstattungsanspruch besteht weder unter dem Gesichtspunkt des Schadensersatzes (wegen unerlaubter Handlung, § 823 Abs. 1 und 2 BGB, oder anstelle eines durch die Gemeinnützigkeit der Straßen etwa ausgeschlossenen Beseitigungsanspruchs, wofür das Berufungsgericht zutreffend auf RGZ 135, 308, 312 hinweist) noch des Aufwendungsersatzes (etwa aus dem Gesichtspunkt der Geschäftsführung ohne Auftrag). Die nachträgliche Entstehung einer Kostentragungspflicht der Beklagten, etwa in entsprechender Anwendung des § 1023 BGB, scheidet aus. Die Zahlungsklage ist daher mit Recht als unbegründet abgewiesen.
B.Feststellungsanspruch.
I.Soweit es sich um die Pflicht der Beklagten handelt, die beiden bereits vorhandenen neuen Schutzbrücken ("Im Rosengarten" und "Freiheitsstraße") in ordnungsmäßigem und sauberem Zustand zu halten, hat das Berufungsgericht ohne Rechtsirrtum das Feststellungsinteresse (§ 256 ZPO) bejaht. In sachlicher Hinsicht gilt das für den Zahlungsanspruch Angeführte (oben A) in vollem Umfang auch hier. Dieser Teil der Feststellungsklage ist daher von den Vorinstanzen ebenfalls ohne feststellbaren Rechtsverstoß als unbegründet abgewiesen worden.
II.Soweit die Klägerin die Feststellung der Pflicht zur Kostentragung und Unterhaltung hinsichtlich künftig etwa noch zu errichtender weiterer Schutzbrücken begehrt, muß entgegen der Auffassung der Vorinstanzen ihr rechtliches Interesse an alsbaldiger Feststellung im Sinne des § 256 ZPO mangels gegenwärtiger Überschaubarkeit der künftigen Entwicklung verneint werden. Allerdings ist mit der Möglichkeit weiterer Geländeerschließung und dadurch notwendig werdender weiterer Schutzbrücken auch heute noch zu rechnen (siehe oben); aber darüber, ob, wann und in welchem Umfang diese Möglichkeit zur Wirklichkeit werden wird, läßt sich, wie dem Parteivortrag zu entnehmen ist, jetzt noch nichts Konkretes sagen. Zwar wird rechtlich auch für die Zukunft als Regel gelten, daß die Klägerin weiter nötig werdende Schutzbrücken auf eigene Kosten zu erstellen und zu unterhalten hat; es ist aber noch in keiner Weise übersehbar und daher nicht auszuschließen, ob und inwieweit besondere Umstände nach § 242 BGB eine Abweichung von der Regel rechtfertigen können (völlig neuartige Erschließungsart, die besonders umfangreiche oder kostspielige Schutzbrücken erfordert; wirtschaftliche Unzumutbarkeit aus anderen Gründen, siehe oben). Es kann dahingestellt bleiben, ob die Klägerin durch die Rechtskraft eines etwa jetzt sachlich abweisenden Urteils gehindert wäre, in einem späteren Rechtsstreit den nunmehrigen Eintritt eines solchen heute noch nicht voraussehbaren Ausnahmefalles geltend zu machen. Auf jeden Fall könnte sie ein schutzwürdiges Interesse daran, daß schon jetzt über den genannten Anspruch entschieden wird, nur dann haben, wenn jene künftigen Verhältnisse mit einiger Sicherheit überschaubar wären, nicht aber an einer Entscheidung, die nur unter Zugrundelegung der derzeit gegebenen oder konkret vorhersehbaren Verhältnisse getroffen werden könnte und für die wirklich in Betracht kommende Zeit möglicherweise gar keine maßgebende Bedeutung besäße (vgl. RGZ 123, 232; der Kritik von Wieczorek, ZPO § 256 D IV, an dieser Entscheidung kann nicht zugestimmt werden).
Aus diesem Grunde war hinsichtlich künftiger Schutzbrücken das Feststellungsinteresse der Klägerin zu verneinen und die Klage deshalb in teilweiser Abänderung der Urteile der Vorinstanzen als unzulässig abzuweisen.
Da die Klägerin trotz dieser Änderung mit ihren Anträgen auch in dieser Instanz voll unterlegen ist, hat sie nach § 97 ZPO auch die Kosten des Revisionsverfahrens zu tragen.