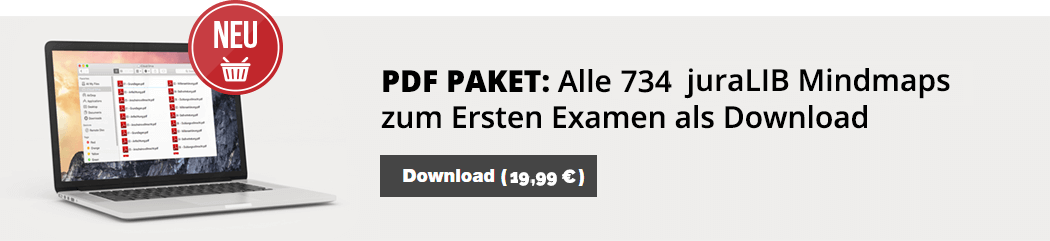Bundesgerichtshof
Entscheidung vom 25.05.1961, Az.: VII ZR 217/59
Tenor
Die Revision der Beklagten gegen das Urteil des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts in Frankfurt/Main vom 16. Oktober 1958 wird zurückgewiesen. Die Beklagte hat die Kosten der Revision zu tragen.
Tatbestand
Die Klägerin ist eine Treibstoffgesellschaft mit einem Netz von mehreren tausend Tankstellen. Die Beklagte hat in den Jahren 1952 und 1953 in ihrer Großtankstelle R. Treibstoffe der Klägerin in deren Namen und für deren Rechnung verkauft.
Die Tankstelle mit zugehörigen Gebäuden wurde 1950 bis 1951 von dem Zahnarzt Dr. Ho. errichtet. Dieser war damals Eigentümer der Grundstücke Nr. 167 und 168. Später erwarb er auch das Grundstück Nr. 169 und mietete die Grundstücke Nr. 162 bis 166 hinzu. Er schloß mit der Rechtsvorgängerin der Klägerin den Tankstellenvertrag vom 11./24. August 1949 und den Mietvertrag vom 12. Dezember 1950. Auf Grund dieser Verträge baute die Rechtsvorgängerin der Klägerin mehrere Tanks und Zapfsäulen ein. Drei in dem Grundstück Nr. 167 liegende Tanks wurden in der Folgezeit teilweise überbaut. Im Grundbuch der Grundstücke Nr. 167 und 168 wurden zugunsten der Treibstoffgesellschaft eine beschränkte persönliche Dienstbarkeit (Tankstellendienstbarkeit) und eine vollstreckbare Grundschuld von 15.000 DM eingetragen.
1952 erwarb die Beklagte, deren Gesellschafter damals die Eheleute H.-G. waren, von Dr. Ho. die Grundstücke Nr. 167 bis 169. Sie schloß mit der Klägerin einen Tankstellenvertrag und einen Mietvertrag vom 19. Juli/9. August 1952. Beide Verträge hatten eine Laufzeit bis Ende 1972.
Mit Schreiben vom 18. November 1953 beschwerte sich die Beklagte bei der Klägerin darüber, daß diese durch Direktlieferungen an Großverbraucher zu ermäßigten Preisen den Absatz der Beklagten beeinträchtige. Mit Schreiben vom 20. Dezember 1954 focht die Beklagte die Verträge aus diesem Grunde an.
Inzwischen hatten die minderjährigen Kinder erster und zweiter Ehe der Frau H.-G., Ingrid Re. und Astrid H.-G. (im folgenden "die Kinder" genannt), im Herbst 1953 die den Grundstücken Nr. 167 und 168 beiderseits benachbarten Grundstücke Nr. 162 bis 166 und 169 erworben. Sie erwirkten, daß die Beklagte den Verkauf von Dieselkraftstoff der Klägerin auf dem Grundstück Nr. 164 einstellte; und vertrieben dort in der Folgezeit selbst Dieselkraftstoff anderer Herkunft. Sie gestatteten die Zufahrt zur Tankstelle über ihr Grundstück Nr. 169 nur gegen eine von der Beklagten an sie zu zahlende beträchtliche Vergütung.
Im Februar 1954 erwarben die Kinder die Geschäftsanteile der Beklagten. Im Mai 1954 gründeten sie eine weitere Gesellschaft, die H.-Re. GmbH, und im Jahre 1955 eine dritte Gesellschaft, die Autohof R. GmbH.
Seit 1954 verkauft die Beklagte in ihrer Tankstelle keine von der Klägerin angelieferten Treibstoffe mehr. Dagegen verkaufen nebenan die H.-Re. GmbH Dieselkraftstoffe und die Autohof R. GmbH Vergaserkraftstoffe anderer Herkunft ("Texas-Gemisch", "Jedermann-Benzin"). Der Verkauf dieser Kraft Stoffe erfolgt - wie die Beklagte behauptet hat - seit 1955 nicht mehr aus den beiden Zapfsäulen der Klägerin. Die Beklagte lagert also nach ihrer Darstellung Vergaserkraftstoff der Klägerin, den diese nicht angeliefert hat, in den drei Tanks und gibt ihn aus den Zapfsäulen ab, welche die Rechtsvorgängerin der Klägerin auf den Parzellen Nr. 167 und 168 eingebaut hat.
Die Klägerin hat mit der Klage von der Beklagten verlangt, diese solle es unterlassen, die drei Tanks und zwei Zapfsäulen der Klägerin zur Lagerung und zum Vertrieb von Treibstoffen zu benutzen, die nicht von der Klägerin selbst hierfür angeliefert worden sind.
Die Klägerin hat sich auf die Verträge, auf ihr Eigentum an den Tanks, auf ihre Tankstellendienstbarkeit sowie auf die §§ 1, 3 UWG und § 24 WZG berufen.
Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Sie hält die Verträge für unwirksam wegen Knebelung, wegen Verstosses gegen Dekartellisierungsvorschriften und gegen das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, wegen ihrer Anfechtung und wegen Kündigung sowie wegen Wegfalls der Geschäftsgrundlage. Sie meint: Die Tanks seien als wesentliche Grundstücksbestandteile ihr Eigentum geworden. Die Dienstbarkeit sei unwirksam. Sie habe auch keinen Wettbewerbsverstoß begangen und Warenzeichen und Ausstattung der Klägerin nicht verletzt.
Das Landgericht hat nach dem Klageantrag erkannt, jedoch mit der Beschränkung auf Treibstoffe, die nicht aus der Produktion der Klägerin stammen. Die Berufung der Beklagten, welche auf die Verurteilung wegen der drei Tanks beschränkt war, hat das Oberlandesgericht zurückgewiesen. Auf die Anschlußberufung der Klägerin hat es der Klage in vollem Umfange stattgegeben.
Hiergegen richtet sich die Revision der Beklagten mit dem Ziele, Klageabweisung im Rahmen ihrer Berufungsanträge zu erreichen. Die Klägerin beantragt, die Revision zurückzuweisen.
Seit 1955 betreibt die Klägerin wegen einer Forderung von rund 34.000 DM aus ihrer Grundschuld von 15.000 DM die Zwangsversteigerung der Grundstücke Nr. 167 und 168.
Die Beklagte hat Vollstreckungsgegenklage erhoben, über die der Senat heute ebenfalls entschieden hat (VII ZR 230/58).
Entscheidungsgründe
A.Die Revisionsanträge umfassen auch die Verurteilung wegen der Zapfsäulen insoweit, als das Berufungsgericht (auf die Anschlußberufung der Klägerin) das landgerichtliche Urteil zum Nachteil der Beklagten abgeändert und die Beklagte weiter verurteilt hat, es zu unterlassen, die zwei Zapfsäulen für den Vertrieb solcher Kraftstoffe zu benutzen, die zwar aus der Produktion der Klägerin stammen, die aber der Beklagten nicht von der Klägerin für den Vertrieb in der Tankstelle angeliefert worden sind.
Insoweit ist die Revision unbegründet, gleichviel, ob die Verträge gültig sind oder nicht.
1)Sind die Verträge wirksam, so gilt Ziffer 3 a des Tankstellenvertrages der Parteien in Verbindung mit Abschnitt c Abs. 1 der zugehörigen, zum Vertragsinhalt gewordenen Ausführungsbestimmungen. Der Tankstellenvertrag ist ein Formularvertrag, den die Klägerin in mehr als einem Oberlandesgerichtsbezirk verwendet. Das Revisionsgericht ist daher in seiner Auslegung frei. Die angeführten Vertragsbestimmungen ergeben, daß die Beklagte vertraglich verpflichtet ist, sich die zum Vertrieb bestimmten Erzeugnisse der Klägerin von dieser unmittelbar und ausschließlich anliefern zu lassen. Sie ist nach dem Vertrage nicht berechtigt, anderswo bezogene Erzeugnisse der Klägerin als Eigenhändler zu vertreiben. Das würde auch ihrer Stellung als Handelsvertreter der Klägerin widersprechen. Selbst wenn der Vertrag keine ausdrückliche Bestimmung hierüber enthielte, würde schon aus § 86 Abs. 1 HGB folgen, daß die Beklagte nicht ohne Einverständnis der Klägerin deren Erzeugnisse als Eigenhändler vertreiben darf.
2)Sind die Verträge unwirksam, so ergibt sich der Unterlassungsanspruch der Klägerin in jedem Falle aus § 1004 BGB, Das Berufungsgericht hat festgestellt, daß die beiden Zapfsäulen Eigentum der Klägerin sind. Dagegen bringt die Revision nichts vor. Als Eigentümer kann die Klägerin die Verwendung der Zapfsäulen zu einem ihr nicht genehmen Zwecke verbieten. Die Beklagte hat nicht geltend gemacht, daß dem Unterlassungsanspruch der Klägerin, soweit es sich um die Zapfsäulen handelt, der Einwand unzulässiger Rechtsausübung (§ 242 BGB) entgegenstünde. Das hat sie nur gegen den Unterlassungsanspruch der Klägerin wegen der Tanks vorgebracht. Darauf ist unten noch einzugehen.
B.Das Berufungsgericht hat seine Verurteilung wegen der Tanks unter anderem auf § 1004 BGB gestützt.
Diese Begründung trägt die Entscheidung.
I.Das Oberlandesgericht ist der Auffassung, daß die Klägerin trotz des Ein- und Überbaus Eigentümerin der Tanks geblieben sei (§ 95 BGB).
Die von der Revision hiergegen gerichteten Rügen sind nicht begründet.
1)Die Rechtsvorgängerin der Klägerin hat als Mieter des Grundstücks nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Tanks "nur zu einem vorübergehenden Zwack" mit dem Grundstück verbunden (§ 95 Abs. 1 Satz 1 BGB). Das folgert das Berufungsgericht ohne Rechtsverstoß aus § 1 Abs. 5 des Mietvertrages und Ziffer 3 des Tankstellenvertrages. Auch wenn diese Vertragsbestimmungen unwirksam sein sollten, so ergibt sich aus ihnen doch der innere Wille des Einfügenden, die Einfügung nur zu vorübergehendem Zweck vorzunehmen (vgl. RGZ 153, 231, 236; 158, 362, 376; BGH LM Nr. 5 zu § 95 BGB). Dieser innere Wille läßt sich auch mit dem nach außen in Erscheinung getretenen Sachverhalt vereinbaren (vgl. RGRK BGB 11. Aufl. § 95 Anm. 14 mit Nachweisungen).
a)Die Revision meint, die Einfügung im Sinne des § 95 BGB sei ein Rechtsgeschäft, dessen Wirksamkeit mit der Gültigkeit der Verträge stehe und falle.
Das trifft nicht zu. Die "Einfügung" ist kein Rechtsgeschäft, sondern eine Tathandlung; der Wille des Einfügenden, daß diese zu einem bestimmten Zwecke erfolge, braucht daher kein rechtsgeschäftlicher zu sein; es genügt ein natürlicher Wille.
b)Baut - wie im vorliegenden Falle - ein Mieter eine eigene Sache in das Mietgrundstück ein, so spricht eine Vermutung dafür, daß er den Einbau zu vorübergehendem Zwecke vollzieht. Davon ist im Zweifel auszugehen, wenn kein gegenteiliger Wille des Einbauenden dargetan ist (Vgl. BGHZ 8, 1, 5 [BGH 31.10.1952 - V ZR 36/51]; 10, 171, 176 [BGH 10.07.1953 - V ZR 22/52]; BGH NJW 1956, 1273 [BGH 13.06.1956 - V ZR 153/54]; 1957, 457 [BGH 21.12.1956 - V ZR 245/55]; LM Nr. 5 und 6 zu § 95 BGB). Im vorliegenden Falle bestehen nach den Feststellungen des Berufungsgerichts keine Anhaltspunkte für einen gegenteiligen Willen des Einfügenden. Weder die Vertragsdauer, noch die Festigkeit der Verbindung brauchten als solche Anhaltspunkte gewertet zu werden.
c)Die Revision meint, die Verträge hätten eine spätere Entfernung der Tanks nur im Interesse des Grundstückseigentümers vorgesehen.
Das läßt sich jedoch den Verträgen nicht entnehmen und wird auch vom Berufungsgericht nicht angenommen. Es kann deshalb dahinstehen, ob es sich auch bei den Mietverträgen der Klägerin mit Dr. Ho. und der Beklagten um für das Revisionsgericht frei auslegbare Formularverträge handelt.
d)Der Umstand, daß Dr. Ho. und die Beklagte das Grundstück auf die Dauer zum Betrieb einer Tankstelle verwenden wollten, schließt nicht aus, daß die Rechtsvorgängerin der Klägerin nach den Feststellungen des Berufungsgerichts die Absicht hatte, die Tanks nur solange in dem Grundstück zu belassen, als sie und ihr Rechtsnachfolger dort als Mieterin des Grundstücks eine Tankstelle für ihre eigenen Erzeugnisse betrieben.
2)Nach Ansicht der Revision soll die teilweise Überbauung durch den Dr. Ho. eine neue Lage geschaffen haben. Nunmehr habe sich nach § 946 BGB das Eigentum am Grundstück in jedem Falle auf die Tanks erstreckt.
Das ist jedoch nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts nicht der Fall.
a)Eine nachträgliche "Änderung der Zweckbestimmung" durch den Dr. Ho. hätte für sich allein nicht genügen können, um das Eigentum der Klägerin an den Tanks auf ihn zu übertragen (BGH LM Nr. 7 zu § 1 Preisstop VO; BGH NJW 1956, 1273, 1274 [BGH 13.06.1956 - V ZR 153/54]; BGHZ 23, 57, 59 [BGH 21.12.1956 - V ZR 245/55]-60; RGRK BGB 11. Aufl. § 95 Anm. 25). Das verkennt auch die Revision nicht.
b)Die Revision meint aber ersichtlich, durch den Überbau habe Dr. Ho. eine erneute, noch engere "Verbindung" der Tanks mit dem Grundstück hergestellt, die nunmehr so unlösbar sei, daß der fortdauernde Wille der Klägerin und ihrer Rechtsvorgängerin, die Sache solle nur zu vorübergehendem Zweck mit dem Grundstück verbunden sein, die Rechtsfolge des § 946 BGB nicht hindern könne.
Das trifft jedoch nicht zu. § 946 BGB knüpft die von ihm ausgesprochene Rechtsfolge nicht unmittelbar an ein bestimmtes Maß von Festigkeit der vorgenommenen Verbindung, sondern macht den Übergang des Eigentums auf den Grundstückseigentümer davon abhängig, daß die eingebaute Sache "wesentlicher Bestandteil" des Grundstücks wird. Wann sie das wird, bestimmt sich nach den §§ 93 ff BGB. Danach ist in der Regel allerdings auf die Festigkeit der Verbindung abzustellen. Für die Ausnahmefälle des § 95 BGB wird aber die Sache trotz einer festen Verbindung im Sinne der §§ 93, 94 BGB nicht wesentlicher Bestandteil, und es tritt daher trotz dieser festen Verbindung die Rechtsfolge des § 946 BGB nicht ein.
So liegt - nach den rechtsfehlerfreien Feststellungen des Berufungsgerichts - der Fall hier. Schon der Einbau der Tanks (ohne den Überbau) hätte diese zu wesentlichen Bestandteilen des Grundstücks gemacht, wenn dem nicht die Zweckbestimmung der einbauenden Treibstoffgesellschaft nach § 95 Abs. 1 Satz 1 BGB entgegengestanden hätte. Der nachträgliche Überbau durch Dr. Ho. mag die "Festigkeit" des Einbaus um einiges verstärkt haben. Darauf kommt es jedoch für § 95 BGB nicht an. Nach dieser Vorschrift ist die mehr oder weniger große Festigkeit des Einbaus unerheblich (vgl. BGH NJW 1956, 1273 [BGH 13.06.1956 - V ZR 153/54]), es sei denn, daß die Verbindung schlechthin unlösbar wäre.
In § 95 BGB sind nämlich ohnehin nur die Fälle geregelt, bei denen der Einbau so fest ist, daß er ohne die entgegenstehende Willensrichtung des Einbauenden dazu führen würde, daß die eingebaute Sache wesentlicher Bestandteil des Grundstücks und damit nach § 946 BGB Eigentum des Grundstückseigentümers würde.
c)Wie die Rechtslage wäre, wenn eine Trennung der eingebauten Sache von dem Grundstück technisch unmöglich wäre, darauf braucht hier nicht näher eingegangen zu werden. Denn ein derartiger Fall liegt nach den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht vor. Derartiges nimmt auch die Revision nicht an. Sie meint nur, ein Ausbau der Tanks würde unverhältnismäßig hohe Kosten verursachen. Darauf kommt es aber in diesem Zusammenhang nicht an.
d)Die Revision vertritt die Ansicht, die Parteien hätten die Zweckbestimmung nachträglich gemeinsam geändert. Das schließe die Anwendung des § 95 BGB von diesem Zeitpunkt an aus.
Die Annahme einer gemeinsamen nachträglichen Zweckänderung ist jedoch mit den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht vereinbar. Es kann daher auf sich beruhen, ob in einer solchen gemeinsamen nachträglichen Zweckänderung eine rechtsgeschäftliche oder rechtsgeschäftsähnliche Verfügung der Parteien gesehen werden könnte, durch welche das Eigentum von der Klägerin auf die Beklagte hätte übergehen können.
3)Die Revision rügt, daß das Berufungsgericht keinen Sachverständigen darüber vernommen hat, ob die Tanks ausgebaut werden können, ohne daß das überbaute Gebäude beschädigt wird, was das Berufungsgericht auf Grund der Aussage des Zeugen Sz. angenommen hat.
Die Rüge ist nicht, begründet. Es kann dahinstehen, ob das Berufungsgericht sich für sachverständig genug Abhalten durfte, diese Frage ohne Zuziehung eines Sachverständigen zu entscheiden. Denn auf die Beweis frage kommt es nicht an. Auch wenn der Ausbau der Tanks nicht ohne Beschädigung der überbauten Gebäude möglich sein sollte, würde das die Anwendbarkeit des § 95 Abs. 1 Satz 1 BGB nicht ausschließen.
4)Die Revision beruft sich auf eine entsprechende Anwendung von § 997 Abs. 2 BGB. Das geht fehl.
§ 997 BGB setzt voraus, daß eine Sache wesentlicher Bestandteil geworden ist. Das ist aber nach den Feststellungen des Berufungsgerichts hier bei den Tanks nicht der Fall.
Die Klage richtet sich im übrigen hier nicht auf Herausgabe oder Wegnahme der Tanks, sondern sie geht auf Unterlassung. Soweit die Beklagte sich demgegenüber auf § 242 BGB beruft, ist darauf unten einzugehen.
5)Da die Auffassung des Berufungsgerichts, die Klägerin sei Eigentümerin der Tanks geblieben, aus § 95 Abs. 1 Satz 1 BGB gerechtfertigt ist, kommt es nicht darauf an, ob dieselbe Rechtsfolge auch aus der Dienstbarkeit der Klägerin in Verbindung mit § 95 Abs. 1 Satz 2 BGB hergeleitet werden kann, wie das Berufungsgericht angenommen hat. Auf die insoweit von der Revision erhobenen Angriffe braucht daher nicht eingegangen zu werden.
II.Das Berufungsgericht führt aus, das Eigentum der Klägerin an den Tanks werde dadurch beeinträchtigt, daß die Beklagte die Tanks zur Lagerung und zum Vertrieb von Treibstoffen verwendet, die nicht von der Klägerin angeliefert worden sind. Das läßt keinen Rechtsirrtum erkennen, wie für die Zapfsäulen bereits oben zu A ausgeführt ist.
Hieraus folgt nach § 1004 BGB der Unterlassungsanspruch der Klägerin.
III.Die Beklagte hat vorgebracht: Die Klägerin verstoße mit ihrer Unterlassungsklage gegen Treu und Glauben (§ 242 BGB). Sie wolle die Tanks im Grundstück liegen lassen, um die Beklagte daran zu hindern, das Grundstück für andere Zwecke als den Kraftstoffvertrieb für die Klägerin zu benutzen. Die Tanks im Grundstück seien "der Pfahl im Fleische der Beklagten", der jede anderweitige Tätigkeit der Beklagten lahmlegen solle. Nur deshalb verlange die Klägerin auf Grund ihres angeblichen Eigentums nicht die Herausgabe der Tanks (§ 985 BGB), sondern beschränke sich darauf, der Beklagten die Benutzung zu verbieten, obwohl diese bereit sei, der Klägerin den Wert der Behälter zu bezahlen.
Ersichtlich mit Rücksicht auf diesen Vortrag hat es das Berufungsgericht für erforderlich erachtet, die von der Beklagten bestrittene Rechtsgültigkeit der Verträge zu prüfen, weil nach seiner Auffassung, wie es ausführt, ohne Bestehen dieser Verträge die Geltendmachung des Unterlassungsanspruchs unter Umständen als Rechtsmißbrauch anzusehen wäre. Das ist in der Tat nicht von der Hand zu weisen.
Das Berufungsgericht hält jedoch alle Einwendungen der Beklagten gegen die Wirksamkeit der Verträge für nicht begründet.
Die Revision greift das an. Ihr Vorbringen kann jedoch zu keiner der Beklagten günstigen Entscheidung führen.
1)Die Revision behauptet einen Dissens in Bezug auf den Mietvertrag der Parteien.
Dieser Vortrag ist neu und kann daher in der Revisionsinstanz nicht berücksichtigt werden. In den Vorinstanzen haben die Parteien zwar über die Auslegung des Mietvertrages gestritten, nämlich darüber, ob der Mietvertrag auch das Grundstück Nr. 169 umfaßt oder nicht. Die Beklagte hatte aber nicht behauptet, daß die von den Parteien abgegebenen Willenserklärungen sich objektiv nicht deckten.
2)Die Beklagte ist der Auffassung, die Verträge seien wegen Knebelung nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig. Das trifft nicht zu.
a)Die Beklagte mag nicht den erwarteten Umsatz erzielt haben. Das begründet aber noch keine Unsittlichkeit der Verträge. Im übrigen haben sich die Gesellschafter der Beklagten den Umsatzrückgang selbst zuzuschreiben. Denn sie haben, vertreten durch Dr. H.-G., ganz bewußt mit dem Ziele, sich vom Vertrag mit der Klägerin zu lösen, den Tankstellenbetrieb der Beklagten lahmgelegt und ihn auf die von ihnen neu gegründeten Gesellschaften, deren alleinige Gesellschafter sie ebenfalls sind, verlagert, um andere Treibstoffe als die der Klägerin im eigenen Namen und für eigene Rechnung mit einer größeren Gewinnspanne verkaufen zu können. Trotz der rechtlichen Selbständigkeit der drei Gesellschaften muß sich die Beklagte nach § 242 BGB unter den obwaltenden Umständen die Maßnahmen ihrer Gesellschafter und des Dr. H.-G. in Bezug auf die Grundstücke und die verschiedenen Gesellschaften zurechnen lassen. Insoweit wird auf die Ausführungen Bezug genommen, welche der Senat unter III 7 seines heutigen. Urteils in dem Rechtsstreit derselben Parteien VII ZR 230/58 gemacht hat.
b)Der Umstand, daß die Beklagte vertraglich verpflichtet ist, nur Erzeugnisse der Klägerin zu vertreiben, welche diese ihr angeliefert hat, begründet keine Sittenwidrigkeit der Verträge. Die Beklagte ist nach den Verträgen Handelsvertreter der Klägerin. Sie darf daher der Klägerin keine Konkurrenz machen, indem sie fremde Erzeugnisse vertreibt (Schlegelberger-Schröder HGB 4. Aufl. § 86 Rz. 16). Das würde sogar dann gelten, wenn die Verträge der Parteien eine ausdrückliche Konkurrenzklausel nicht enthielten.
3)Die Beklagte hat die Verträge wegen arglistiger Täuschung angefochten. Das Berufungsgericht stellt jedoch fest, daß sie dazu kein Recht gehabt hat.
Die Revision rügt in diesem Zusammenhang, daß das Berufungsgericht die Vernehmung der Zeugen Z. und St. sowie der Sachverständigen Keiser oder Kirchhoff abgelehnt hat.
Z., Keiser und Kirchhoff waren dem Berufungsurteil zufolge von der Beklagten "zur näheren Beleuchtung der allgemeinen Absatzverhältnisse auf dem Treibstoffmarkt" benannt (S. 48 a.a.O.). Das Berufungsgericht brauchte diese Beweise nicht zu erheben; denn es kam zur Entscheidung darüber, ob die Verträge der Parteien anfechtbar sind, nicht auf diese allgemeinen Verhältnisse, sondern nur auf die besonderen bei den Parteien gegebenen Verhältnisse an.
St. war, ebenfalls dem Urteil zufolge, dazu benannt, daß die Klägerin infolge verstärkten Wettbewerbs seit Anfang 1958 wieder höhere als die vom Zeugen J. zunächst genannten Nachlässe gewährt habe (S. 49). Davon geht aber auch das Berufungsgericht auf Grund der weiteren Aussage J.s aus. Unter diesen Umständen brauchte es St. nicht zu vernehmen.
4)Die Beklagte hat geltend gemacht, in dem Schreiben der Beklagten vom 20. Dezember 1954 sei, auch wenn die darin enthaltene Anfechtungserklärung nicht wirksam sei, jedenfalls eine fristlose Kündigung des Vertragsverhältnisses der Parteien zu erblicken. Auch sei dadurch, daß die Klägerin Großabnehmer unter Gewährung erheblicher Rabatte direkt beliefert hat, die Geschäftsgrundlage der Verträge entfallen.
Die Rüge ist nicht begründet.
a)Das Berufungsgericht stellt fest, daß die "Nichtbelieferung von Kunden im Direktgeschäft" durch die Klägerin und die Einhaltung "bestimmter Preisgrenzen" im Direktgeschäft nicht Geschäftsgrundlage der Verträge gewesen sei. Das läßt keinen Rechtsfehler erkennen.
Das Berufungsgericht legt weiter dar, es habe keine so erhebliche Ausweitung der "Direktgeschäfte" der Klägerin stattgefunden, daß dem Vertragsverhältnis der Parteien der Boden entzogen worden wäre.
Wenn die Revision demgegenüber meint, die Möglichkeit "eines bestimmten Absatzes" sei Geschäftsgrundlage genesen, so ist das mit den Feststellungen des Berufungsgerichts nicht vereinbar.
b)Den Umfang der Direktgeschäfte der Klägerin in Dieselkraftstoff hat das Berufungsgericht nicht außer acht gelassen. Es stellt fest, die Klägerin habe den Direktabsatz von Dieselkraftstoff erst ausgeweitet, nachdem die Beklagte sich von den Verträgen losgesagt und am 1. Oktober 1953 den Bezug von Dieselkraftstoff bei der Klägerin eingestellt hatte, sowie daß bis dahin kein Umsatzrückgang bei der Beklagten eingetreten sei.
Wenn die Revision demgegenüber ausführt, die Maßnahmen der Klägerin hätten die Beklagte gezwungen, "andere Wege zu gehen", so kehrt sie damit den vom Berufungsgericht festgestellten Ursachenverlauf um.
c)Im übrigen hat nicht die Klägerin die Lieferungen an die Beklagte eingestellt, sondern die Beklagte war nicht mehr bereit, von der Klägerin zu den vertraglichen Bedingungen und Preisen zu beziehen. Der Hinweis der Revision auf die Bereitschaft der Beklagten zur Barzahlung geht fehl. Denn die Beklagte beanspruchte die gleichen Preisnachlässe, wie die Klägerin sie ihren Direktabnehmern gewährte. Darauf brauchte sich die Klägerin nach den Verträgen aber nicht einzulassen.
d)Hiernach hat das Berufungsgericht auch ein Recht der Beklagten, die Verträge vorzeitig zu kündigen, ohne Rechtsverstoß verneint. Wieso der Umstand, daß die Beklagte nach den Verträgen keine Inkassoprovision zu beanspruchen hat, die Befugnis der Beklagten zu fristloser Kündigung erweitert haben sollte, wie die Revision annimmt, ist nicht verständlich.
5)Die Revision meint, die Verträge der Parteien seien wegen Verstoßes gegen die Art. 85, 86 des Vertrages zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) (BGBl. 1957 II S. 766, 824, 826) unwirksam, und darüber müsse nach Art. 177 a.a.O. der Gerichtshof der EWG entscheiden.
Die Rüge ist abwegig.
Art. 85 erklärt Absprachen für nichtig, welche den Handel zwischen Mitgliedstaaten der EWG zu beeinträchtigen geeignet sind und eine Verhinderung, Einschränkung oder Verfälschung des Wettbewerbs innerhalb des Gemeinsamen Marktes bezwecken oder bewirken. Art. 86 verbietet die mißbräuchliche Ausnutzung einer beherrschenden Stellung auf dem Gemeinsamen Markt oder auf einem wesentlichen Teil desselben durch einen oder mehrere Unternehmer, soweit dies dazu führen kann, den Handel zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.
Die Verträge der Parteien erfüllen diese Voraussetzungen nicht. Sie sind nicht geeignet, den zwischenstaatlichen Handel und Wettbewerb der EWG-Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen.
6)Die Beklagte ist der Auffassung, die Verträge seien nichtig wegen Verstoßes gegen die damals geltenden Dekartellisierungsvorschriften (Art. I 2 US MilRegG 56).
Das geht fehl. Tankstellenverträge, die den als Handelsvertreter einer bestimmten Mineralölgesellschaft tätigen Verwalter einer Tankstelle auf den Vertrieb der Erzeugnisse dieser Gesellschaft beschränken, verstießen, wie der Bundesgerichtshof inzwischen entschieden hat, nicht gegen die Dekartellisierungsvorschriften der Besatzungsmächte (LM Nr. 19 zu Art. V MRVO BrZ 78 = NJW 1959, 1679).
7)Die Beklagte hat sich endlich darauf berufen, die Verträge der Parteien verletzten auch die nach ihrem Abschluß in Kraft getretenen §§ 15 und 18 Abs. 1 Nr. 2 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen vom 27. Juli 1957 (GWB). Infolgedessen seien sie nach § 106 Abs. 1 GWB am 1. Juli 1958 unwirksam geworden. Auch die Revision trägt das wieder vor. Sie meint, der erkennende Senat des Bundesgerichtshofs sei nach Art. 96 Abs. 2 GWB gehalten, den Rechtsstreit bis zur Entscheidung der zuständigen Kartellbehörden und -gerichte über diese kartellrechtlichen Vortragen auszusetzen.
Soweit es sich um den § 18 Abs. 1 Nr. 2 GWB handelt, bedarf es einer Aussetzung nach § 96 Abs. 2 GWB schon deswegen nicht, weil die Beklagte nicht behauptet hat, daß die Kartellbehörde gemäß dieser Vorschrift bereits eingeschritten wäre (vgl. BGH LM Nr. 1 zu § 18 GWB; BGH GRUR 1959, 613, 615).
Aber auch im übrigen ist eine Aussetzung nach § 96 Abs. 2 GWB im vorliegenden Falle nicht erforderlich.
a)Da es sich um einen Unterlassungsanspruch handelt, der in die Zukunft wirkt, ist allerdings hier (im Gegensatz zu der Sache VII ZR 230/58) die nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen seit dem 1. Juli 1958 bestehende Rechtslage nicht schon aus Zeitgründen für das hier zu entscheidende Rechtsverhältnis unerheblich.
b)Das Berufungsgericht hat ausgeführt, von § 15 GWB werde die Ausschließlichkeitsklausel der Tankstellenverträge "schon tatbestandsmäßig nicht betroffen".
Es ist der Revision zuzugeben, daß das Berufungsgericht mit dieser Begründung die Notwendigkeit einer Aussetzung nach § 96 Abs. 2 GWB nicht verneinen durfte. Denn diese Begründung enthält bereits eine Stellungnahme zu der von der Beklagten aufgeworfenen kartellrechtlichen Vortrage, über welche das Berufungsgericht nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen nicht selbst entscheiden durfte. Auch der erkennende Senat ist aus Rechtsgründen nicht in der Lage, zu dieser kartellrechtlichen Vortrage Stellung zu nehmen. Würde daher die Entscheidung des Rechtsstreits von ihr abhängen, so müßte der Senat nach § 96 Abs. 2 GWB das Verfahren bis zu ihrer Entscheidung durch das Kartellgericht aussetzen (BGH LM Nr. 1 zu § 87 GWB; Nr. 2 zu § 96 Abs. 2 GWB; VII ZR 3/58 vom 24. September 1959).
Eine Ausnahme würde nur dann bestehen, wenn das nach dem Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu beurteilende Rechtsverhältnis zwischen den Parteien in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht unstreitig wäre und das Prozeßgericht in Übereinstimmung damit seinerseits die Sach- und Rechtslage für völlig unzweifelhaft halten würde (BGHZ 30, 186). Diese Voraussetzungen sind hier schon deswegen nicht gegeben, weil die Rechtslage auch jetzt noch zwischen den Parteien streitig ist, wie sich in der Revisionsverhandlung ergeben hat.
c)Die Frage des angeblichen Verstoßes der Verträge gegen § 15 GWB ist jedoch vorliegend nicht entscheidungserheblich.
Das ist deswegen nicht der Fall, weil die Klage hier schon auf Grund der außervertraglichen Anspruchsgrundlage des § 1004 BGB (Störung des Eigentums der Klägerin an den Tanks durch die Beklagte) begründet ist, wie vorstehend zu B I und II ausgeführt ist.
Wie oben dargelegt, steht der Klägerin der erhobene Unterlassungsanspruch nach § 1004 BGB zu, weil die Beklagte ihr Eigentum an den Tanks beeinträchtigt. Es handelt sich in diesem Zusammenhang nur darum, ob die Rechtsverfolgung der Klägerin etwa deshalb einen Rechtsmißbrauch enthält, weil die Verträge der Parteien unwirksam sind.
Es ist schon zweifelhaft, ob der Sachvortrag der Beklagten zu diesem Punkte genügend substantiiert wäre.
Das kann jedoch auf sich beruhen.
Entscheidend ist jedenfalls, daß die Beklagte, wenn sie sich auf das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen beruft, keinen den Verträgen von Anbeginn anhaftenden Mangel geltend macht. Die Verträge könnten höchstens später, nämlich vom 1. Juli 1958 an, unwirksam geworden sein.
Selbst wenn dies durch eine Entscheidung des Kartellgerichts noch festgestellt werden würde, so verstößt die Klägerin keinesfalls gegen Treu und Glauben, wenn sie, solange ein solcher Ausspruch noch nicht ergangen ist, die aus ihrem Eigentum sich ergebenden Rechte geltend macht, und zwar auch den Unterlassungsanspruch. Denn soviel kann unbedenklich gesagt werden, daß die Rechtslage keineswegs eindeutig gegen die Klägerin spricht; es ist nicht so, daß die Klägerin mit Sicherheit oder mit erheblicher Wahrscheinlichkeit damit rechnen müßte, die Verträge seien nach § 106 GWB nachträglich unwirksam geworden, und es sei demnächst eine entsprechende Entscheidung durch die Kartellgerichte zu erwarten. Die Klägerin darf vielmehr bei der gegebenen Sachlage mit einer gewissen Berechtigung auch weiterhin von der Gültigkeit der Verträge ausgehen, zumal die Beklagte nicht vorgetragen hat, daß sie ihrerseits die kartellrechtlichen Instanzen angerufen hat, und überdies alle von der Beklagten sonst vorgebrachten - außerkartellrechtlichen - Gründe für eine Unwirksamkeit der Verträge nach den vorstehenden Ausführungen fehlgehen. Durfte und darf aber die Klägerin noch auf die Fortdauer der Verträge vertrauen, die eine vereinbarte Laufzeit bis zum Jahre 1972 haben, so kann ihr jedenfalls im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht der Vorwurf rechtsmißbräuchlichen Handelns deswegen gemacht werden, weil sie auf Grund ihres Eigentums nicht die Herausgabe der Tanks, sondern die Unterlassung begehrt.
Denn bei Fortbestand der Verträge hat die Klägerin Anspruch darauf, daß die Tanks bis 1972 im Grundstück liegen bleiben und daß die Beklagte Lagerung und Vertrieb fremder Treibstoffe mit Hilfe dieser Tanks unterläßt.
IV.Da nach alledem die Klage schon aus § 1004 BGB begründet ist, braucht auf die weiteren vom Berufungsgericht erörterten Rechtsgrundlagen (Dienstbarkeit; §§ 1, 3 UWG; § 24 WZG) sowie auf die von der Revision hiergegen erhobenen Rügen nicht eingegangen zu werden.
Die Beklagte hat nach § 97 ZPO die Kosten ihrer unbegründeten Revision zu tragen.