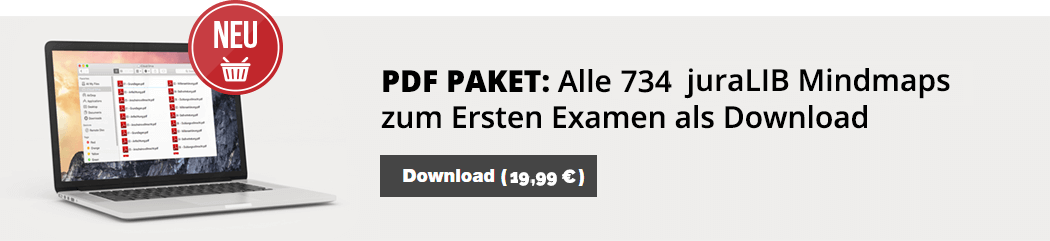Bundesgerichtshof
Entscheidung vom 03.07.1991, Az.: VIII ZR 190/90 - BGHZ 115, 103
Tatbestand
Die Klägerin betrieb in der T.straße in H. eine Gaststätte. Die benötigte elektrische Energie bezog sie von der Beklagten. Wegen - inzwischen titulierter - Zahlungsrückstände von 6.327,41 DM schaltete die Beklagte Ende August 1986 die Gaststätte vom Versorgungsnetz ab und kündigte den Stromlieferungsvertrag. Die Gaststätte wurde am 1. September 1986 geschlossen. Die Rückstände bestehen in unveränderter Höhe fort. Die Klägerin ist zu deren Ausgleich nicht in der Lage.
Seit Anfang 1985 versorgte die Beklagte aufgrund eines weiteren Stromlieferungsvertrages auch die in H., B. 20 a gelegene Wohnung der Klägerin mit Elektrizität. Die hierfür anfallenden Stromrechnungen wurden und werden von der Sozialhilfe bezahlt. Zum Haushalt der Klägerin gehört ihre im Juni 1985 geborene Tochter.
Nach einem fruchtlosen Vollstreckungsversuch aus dem über die Zahlungsrückstände aus dem Gaststättenbetrieb erwirkten Titel drohte die Beklagte der Klägerin mit Schreiben vom 13. Januar 1988 an, den Strom für die Wohnung zu sperren, falls innerhalb von zwei Wochen keine Einigung über die Begleichung der Rückstände erzielt werde. Dazu kam es nicht. Am 4. März 1988 schaltete die Beklagte sodann den Strom ab, nahm die Versorgung am Abend desselben Tages unter Vorbehalt aber wieder auf.
Das Sozialamt der Stadt H., an das sich die Klägerin gewandt hatte, lehnte es mit - bestandskräftig gewordenem Bescheid vom 4. März 1988 ab, die Stromschulden aus dem Gaststättenbetrieb zu übernehmen.
Die Klägerin hat, wie ihr im vorausgegangenen einstweiligen Verfügungsverfahren aufgegeben worden ist, klageweise die Feststellung begehrt, daß die Beklagte nicht berechtigt sei, die Energieversorgung des jeweiligen Privathaushaltes der Klägerin im Vertragsgebiet der Beklagten deshalb zu unterbrechen, weil die Klägerin aus dem Stromlieferungsvertrag für die Gaststätte noch zur Zahlung von Stromschulden in Höhe von 6.327,41 DM verpflichtet sei.
Das Landgericht hat der Klage stattgegeben. Die dagegen gerichtete Berufung der Beklagten ist vom Oberlandesgericht zurückgewiesen worden. Mit der Revision erstrebt die Beklagte weiterhin die Abweisung der Klage.
Entscheidungsgründe
Das angefochtene Urteil hält im Ergebnis der rechtlichen Nachprüfung stand.
I. Das Berufungsgericht hat ausgeführt, nach § 33 Abs. 2 Satz 1 AVBEltV sei das Versorgungsunternehmen zwar befugt, bei Nichterfüllung einer Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung die Versorgung des Kunden zwei Wochen nach Androhung einzustellen. Auch habe die Klägerin eine der Beklagten gegenüber bestehende Zahlungsverpflichtung trotz Mahnung nicht erfüllt. Gleichwohl sei die Beklagte selbst dann nicht zu einer Stromsperre berechtigt, wenn man unterstelle, daß § 33 Abs. 2 Satz 1 AVBEltV anders als § 273 BGB kein "innerlich zusammenhängendes einheitliches Lebensverhältnis" zwischen der nichterfüllten Zahlungspflicht des Kunden und der Stromlieferungspflicht des Versorgungsunternehmens voraussetze, sondern daß für die Anwendbarkeit des § 33 Abs. 2 Satz 1 AVBEltV der Verzug des Kunden mit einer beliebigen Zahlungsverpflichtung genüge. Denn jedenfalls müsse sich das Versorgungsunternehmen bei der Ausübung seines Rechts zur Versorgungseinstellung über die in § 33 Abs. 2 Satz 2 AVBEltV vorgesehene Einschränkung hinaus von Treu und Glauben (§ 242 BGB) leiten lassen. Dagegen würde die Beklagte verstoßen und unzulässige Rechtsausübung betreiben, wenn sie die Belieferung der Klägerin mit "privatem Strom" unterbräche. Dadurch würde für die Klägerin, die insbesondere auch zur lebensnotwendigen Versorgung ihres Kindes auf elektrischen Strom angewiesen sei, eine unerträgliche Lage geschaffen. Der Beklagten entstehe durch die Weiterversorgung der Klägerin mit Haushaltsstrom auch kein Schaden, weil diese Leistung nach wie vor von der Sozialhilfe bezahlt werde. Ein - den Vorwurf rechtsmißbräuchlichen Verhaltens der Beklagten möglicherweise ausschließender - Anspruch der Klägerin gegenüber der Sozialhilfe, auch die Stromschulden aus dem Versorgungsvertrag über ihren ehemaligen gewerblichen Gaststättenbetrieb zu übernehmen, bestehe nicht. Der ablehnende Bescheid des Sozialamtes gebe diese Rechtslage zutreffend wieder. Der Einwand rechtsmißbräuchlichen Handelns sei bei verfassungskonformer Auslegung der Regelung in § 33 Abs. 2 AVBEltV nicht ausgeschlossen. Wäre sie so zu verstehen, wie die Beklagte meine, so wäre die Verordnung insoweit wegen Verstoßes gegen die Ermächtigungsnorm des § 7 Abs. 2 EnergWiG unwirksam. Die allgemeinen Bedingungen der Energieversorgungsunternehmen wären nicht ausgewogen gestaltet und die beiderseitigen interessen bei der Festlegung der Rechte und Pflichten der Vertragspartner nicht angemessen berücksichtigt.
II. Es kann offenbleiben, ob der - angedrohten - Liefersperre, wofür allerdings einiges spricht, mit Erfolg der Einwand des Rechtsmißbrauches entgegengehalten werden könnte. Denn ungeachtet dieses Gesichtspunktes ist die Beklagte nicht berechtigt, die Versorgung der Klägerin mit Strom für ihre Wohnung deshalb einzustellen, weil noch Zahlungsrückstände aus einem früheren - die Gaststätte betreffenden selbständigen Versorgungsverhältnis bestehen.
1. Die dem Elektrizitätsversorgungsunternehmen in § 33 Abs. 2 Satz 1 AVBEltV eingeräumte Befugnis, die Stromversorgung des Tarifkunden zwei Wochen nach Androhung zu unterbrechen, sofern dieser Zahlungsverpflichtungen trotz Mahnung nicht erfüllt, ist eine besondere Ausgestaltung der Leistungsverweigerungsrechte nach §§ 273, 320 BGB (vgl. BVerfG, Beschluß vom 30. September 1981 = NJW 1982, 1511, 1512; Senatsurteil vom 26. April 1989 - VIII ZR 12/88 = WM 1989, 1023, 1024 zu der inhaltsgleichen Vorschrift des § 33 Abs. 2 Satz 1 AvBFernwärmeV; OLG Hamm, RdE 1986, 76; Hermann in Hermann/Recknagel/Schmidt-Salzer, Kommentar zu den Allgemeinen Versorgungsbedingungen, Bd. II, § 33 AVBV Rdnr. 24 m.w.Nachw.; Hempel, Aktuelle Fragen des Zurückbehaltungsrechts nach § 33 Abs. 2 AVBEltV beim Zahlungsverzug des Kunden, RdE 1989, 58, 59) . Die Vorschrift tritt im Energieversorgungsbereich nicht an die Stelle der im Bürgerlichen Gesetzbuch jedermann eingeräumten Leistungsverweigerungsrechte, sondern stellt zugunsten des Tarifkunden lediglich zusätzliche Erfordernisse für die Inanspruchnahme dieser Rechte durch das Versorgungsunternehmen auf (Senatsurteil vom 26. April 1989 aaO) . Das bedeutet, daß bei einer Liefersperre neben der in § 33 Abs. 2 Satz 1 AVBEltV vorgeschriebenen ausdrücklichen Mahnung und Androhung auch den allgemeinen Anforderungen der §§ 273 oder 320 BGB genügt sein muß.
2. Das ist hier nicht der Fall.
Da die nichterfüllte Zahlungsverpflichtung und der Anspruch der Klägerin auf Stromversorgung, deren Einstellung die Beklagte angedroht hat, nicht auf ein und demselben gegenseitigen Vertrag beruhen und daher die Anwendung des § 320 BGB von vornherein ausscheidet, kommt als Grundlage für eine Liefersperre allein § 273 BGB in Betracht
a) Danach müssen die Verpflichtung des Schuldners und sein Anspruch, wegen dessen Nichterfüllung er die von ihm geschuldete Leistung zurückbehalten will, aus "demselben rechtlichen Verhältnis" stammen. Dieser Begriff ist weit auszulegen. Er erfordert nicht, daß die sich gegenüberstehenden Ansprüche auf demselben Rechtsverhältnis beruhen. Vielmehr genügt es, wenn ihnen ein innerlich zusammenhängendes, einheitliches Lebensverhältnis zugrundeliegt, beide also, falls sie - wie hier - eine vertragliche Grundlage haben, aus Rechtsgeschäften hervorgegangen sind, die in einem solchen natürlichen und wirtschaftlichen Zusammenhang stehen, daß es gegen Treu und Glauben verstoßen würde, wenn der eine Anspruch ohne Rücksicht auf den der anderen Seite zustehenden geltend gemacht und durchgesetzt werden könnte.
b) Ein derartiger Zusammenhang wird in der amts- und landgerichtlichen Rechtspr. fast einhellig bejaht, wenn ein Stromabnehmer in demselben Versorgungsgebiet in eine andere Wohnung verzieht und hinsichtlich der aufgegebenen Wohnung Zahlungsrückstände bestehen. Neben der Identität der Vertragspartner und des Vertragsgegenstandes stellen hier die gleichartigen Abnahmeverhältnisse den erforderlichen (wirtschaftlichen) Zusammenhang her, der es in diesen Fällen in der Tat treuwidrig erscheinen ließe, wenn der Tarifkunde auf der Energiebelieferung aus dem neuen Versorgungsverhältnis beharren könnte, ohne seine Rückstände aus dem früheren Versorgungsverhältnis zu bezahlen.
Gleiches mag auch gelten, wenn sich die verschiedenen Energielieferungsverträge - bei fehlender Gleichartigkeit der Abnahmeverhältnisse - wegen ihres sachlichen Zusammenhangs als eine natürliche Einheit darstellen, etwa wenn die Versorgung einer Gaststätte und Wirtewohnung oder einer Arztpraxis und des Arzthaushaltes jeweils im gleichen Haus über denselben Hausanschluß erfolgt (so Hermann aaO Rdnr. 29; Hempel aaO S. 63).
c) Anders liegt es indessen, sofern sich die mehreren selbständigen Versorgungsverträge, in denen die einander gegenüberstehenden Ansprüche des Kunden auf Lieferung und des Versorgungsunternehmens auf Bezahlung ihre Grundlage haben, auf getrennte Anschlußobjekte beziehen und verschiedenen Zwecken dienen Das ist der Fall, wenn - wie im Streitfall der eine Energielieferungsvertrag die Versorgung der Privatwohnung und der andere - an einer selbständigen Abnahmestelle - die eines Gewerbebetriebes des Kunden zum Inhalt hat. Diese solchermaßen gegenständlich und räumlich voneinander unabhängigen Versorgungsverhältnisse sind derart unterschiedlichen Lebensbereichen zugeordnet und zur Befriedigung so verschiedenartiger Bedürfnisse bestimmt, daß es nicht gegen Treu und Glauben verstößt, Stromlieferung für die Privatwohnung ohne Rücksicht auf Zahlungsrückstände zu beanspruchen, die aus der Versorgung der gewerblichen Abnahmestelle stammen (so im Ergebnis zutreffend LG Aachen, RdE 1989, 78 und LG Wiesbaden, RdE 1989, 80).
Soweit in der instanzgerichtlichen Rechtsprechung eine andere Auffassung vertreten wird, beruht dies überwiegend darauf, daß für die Liefersperre wegen nichterfüllter Zahlungsverpflichtungen nach § 33 Abs. 2 AVBEltV fälschlicherweise das Erfordernis der Konnexität im Sinne des § 273 BGB geleugnet (etwa LG Stuttgart, RdE 1983, 28 und AG Koblenz, RdE 1989, 83) oder die Konnexität mit der Identität der Vertragspartner bejaht wird (so etwa AG Bad Kreuznach, RdE 1989, 84), obwohl dieser Umstand allein die in § 273 BGB außerdem vorausgesetzte Gegenseitigkeit der Ansprüche betrifft.