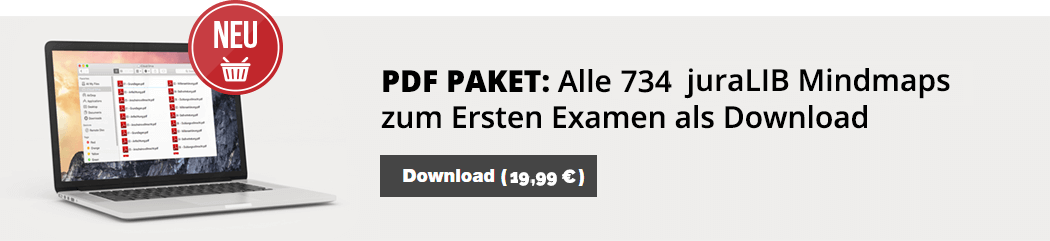Bundesverwaltungsgericht
Entscheidung vom 26.06.1980, Az.: 2 C 8/78
Tenor
Das Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin vom 15. Oktober 1976 wird aufgehoben.
Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an das Oberverwaltungsgericht Berlin zurückverwiesen.
Die Entscheidung über die Kosten bleibt der SchluÃentscheidung vorbehalten.
Entscheidungsgründe
I.Der 1924 geborene Kläger war ab 1961 zunächst als Verwaltungsangestellter im Bereich der Sondervermögens- und Bauverwaltung beim damaligen Landesfinanzamt Berlin tätig und wurde am 1. Juni 1963 unter Berufung in das Beamtenverhältnis auf Probe zum Finanzassessor ernannt. Am 1. Dezember 1964 wurde er als Beamter auf Lebenszeit zum Regierungsrat ernannt und am 30. November 1970 zum Oberregierungsrat befördert.
Am 1. November 1973 gab die Beklagte über den Kläger, der zu dieser Zeit als Hilfsreferent in einer Rückerstattungsgruppe eingesetzt war, für die Zeit vom 1. April 1971 bis zum 30. September 1973 eine regelmäÃige dienstliche Beurteilung ab, die u.a. wie folgt lautet:
III. Einzelbeurteilung1.Allgemeine geistige Veranlagungbedächtig, arbeitet gründlich, manchmal etwa umständlich2.Organisatorische und praktische Befähigungausreichend vorhanden3.Fähigkeit zum freien Vortrag und zur Leitung von VerhandlungenVortrag mitunter stockend aber dennoch verständlich, als Verhandlungsleiter bedingt geeignet4.Schriftliche Ausdrucks- und Darstellungsweisebemüht sich um flüssigen Stil, im übrigen verständlich5.Auftreten, Umgangsformnicht zu beanstanden6.Verkehr mit Publikumzurückhaltend, bestimmt7.Bewährung als Vorgesetzterhat sich nicht uneingeschränkt bewährt
IV. Zusammenfassende Beurteilung der Leistung und Eignung
Oberregierungsrat Th. wirkt gegenüber Vorgesetzten oft wenig umgänglich, gehemmt und verschlossen, was für seinen Umgang mit Kollegen und Untergebenen nicht gilt. Er ist allgemein etwas umständlich, aber bemüht, seine Aufgaben unbeanstandet zu erfüllen, was ihm leichter fiele, wenn er den dienstlichen Belangen gegenüber eine etwas aufgeschlossenere Einstellung finden könnte.
V. Gesamturteil
entspricht den Anforderungen.
Der Kläger beantragte, diese Beurteilung aufzuheben und eine neue unter Berücksichtigung aller Beurteilungsquellen anzufertigen. Er machte geltend, die Beurteilung sei in den einzelnen Punkten unrichtig und im übrigen auch deshalb fehlerhaft, weil seine unmittelbaren Vorgesetzten nicht gehört worden seien. Die Beklagte änderte die dienstliche Beurteilung hinsichtlich einer zwischen den Beteiligten nicht mehr umstrittenen, einschränkenden Bemerkung über die körperliche Belastbarkeit ab, wies die übrigen Einwendungen des Klägers jedoch zurück. Der Widerspruch des Klägers blieb erfolglos. Der Klage mit dem Antrag, die Beklagte unter Aufhebung ihres Bescheides vom 18. Januar 1974, soweit darin eine Ãnderung der Beurteilung vom 1. November 1973 abgelehnt worden ist, und Aufhebung des Widerspruchsbescheides vom 21. März 1974 zu verpflichten, den Kläger für den Zeitraum vom 1. April 1971 bis 30. September 1973 neu zu beurteilen, hat das Verwaltungsgericht mit Urteil vom 13. November 1974 stattgegeben. Zur Begründung hat es im wesentlichen dargelegt, die in den Positionen III/3, III/7 und IV enthaltenen Bewertungen seien entgegen der Verpflichtung des Dienstherrn, im Verwaltungsstreitverfahren die der Beurteilung zugrundeliegenden Tatsachen zu offenbaren, nicht mit Tatsachen belegt worden. Da der Antrag des Klägers auf Abänderung der dienstlichen Beurteilung schon aus diesem Grunde Erfolg haben müsse, komme es auf die übrigen Beanstandungen nicht mehr an. Die Berufung der Beklagten hat das Oberverwaltungsgericht Berlin mit Urteil vom 15. Oktober 1976 zurückgewiesen, im wesentlichen aus folgenden Gründen:
Die dienstliche Beurteilung unterliege als dem Dienstherrn vorbehaltener Akt wertender Erkenntnis nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zwar nur eingeschränkter verwaltungsgerichtlicher Ãberprüfung. Diese aus der Beurteilungsermächtigung der wertenden Behörde folgende Begrenzung der gerichtlichen Kontrolle entbinde den Dienstherrn aber nicht von der Verpflichtung, im Streitfall die der Beurteilung zugrundeliegenden Tatsachen zu offenbaren, d.h. im Falle einer Klage des Beamten auf Ãnderung der dienstlichen Beurteilung durch Angabe von Tatsachen die Berechtigung der Werturteile darzulegen und unter Beweis zu stellen. Nur so könne das Gericht die RechtmäÃigkeit der Beurteilung prüfen. Ohne Kenntnis der tatsächlichen Grundlagen könne es dagegen nicht feststellen, ob der Beurteilende von einem zutreffenden Sachverhalt ausgegangen sei, allgemein gültige BewertungsmaÃstäbe beachtet und sachgerechte Erwägungen angestellt habe. Auch der Beamte, der nicht die Darlegungs- oder Beweislast für die Unrichtigkeit der über ihn abgegebenen Werturteile trage, sei ohne Kenntnis der zugrundeliegenden Tatsachen nicht in der Lage, die Rechtswidrigkeit einer Beurteilung darzulegen. Die Beklagte bewege sich bei der Abgabe dienstlicher Beurteilungen nicht in einem "gerichtsfreien Raum". Vielmehr habe der Beamte nach Art. 19 Abs. 4 GG gegenüber rechtswidrigen Beurteilungen - namentlich solchen, die auf Grund eines unrichtigen Sachverhalts abgegeben worden seien - Anspruch auf wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz. Eine Einschränkung der gerichtlichen Kontrolle ergebe sich lediglich aus der rechtlichen Ausgestaltung dienstlicher Beurteilungen als persönlichkeitsbedingten Werturteilen. Nur der Dienstherr oder der für ihn handelnde jeweilige Vorgesetzte solle ein Urteil darüber abgeben, ob und inwieweit der einzelne Beamte den - ebenfalls vom Dienstherrn zu bestimmenden - fachlichen und persönlichen Anforderungen des konkreten Amtes und der Laufbahn entspreche. Hierdurch sei den Verwaltungsgerichten aber nur verwehrt, das persönlichkeitsbedingte Werturteil selbst zu vollziehen und die fachliche und persönliche Beurteilung des Beamten durch den Dienstvorgesetzten durch ihre eigene Beurteilung zu ersetzen. - Die Beklagte habe - auch im Berufungsverfahren - hinsichtlich der vom Kläger beanstandeten Einzelurteile und der zusammenfassenden Beurteilung keinen Sachverhalt vorgetragen, der die abgegebenen Werturteile rechtfertigen könnte. Ihr Vorbringen, der die Beurteilung entwerfende Beamte habe sein Urteil auf Grund der in der dienstlichen Zusammenarbeit gewonnenen, mit den Beobachtungen der früheren Vorgesetzten des Klägers übereinstimmenden Eindrücke von Auftreten, Wesensart und Persönlichkeit des Klägers nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben, enthalte keine nachprüfbaren Tatsachen und reiche deshalb nicht aus. Soweit die Beklagte zur Einzelbeurteilung III/3 geltend mache, daà bereits im Jahre 1970 nach Beendigung einer Abordnung des Klägers Zweifel an seinem Verhandlungsgeschick bestanden hätten, ergäben sich aus diesem Vorbringen, das überdies nicht den hier maÃgeblichen Beurteilungszeitraum betreffe, keine nachprüfbaren Tatsachen. Das gleiche gelte für das Vorbringen der Beklagten zur Einzelbeurteilung III/7, die allgemeine Verhaltensweise und das Auftreten des Klägers im dienstlichen Bereich lieÃen jegliche Personalführungsqualität vermissen. SchlieÃlich sei auch die in Abschnitt IV der dienstlichen Beurteilung enthaltene Bemerkung, daà der Kläger gegenüber den dienstlichen Belangen eine etwas aufgeschlossenere Einstellung finden könnte, durch keinerlei Tatsachen begründet worden, die diesen Vorwurf und die in ihm liegende Abweichung von der vorangegangenen dienstlichen Beurteilung rechtfertigen könnten. Auf die von der Beklagten zur Rechtfertigung der Einzelbewertungen III/1 und III/4 gegebene Darstellung komme es nicht an, weil diese vom Verwaltungsgericht nicht abschlieÃend geprüft worden seien und der Kläger gegen das erstinstanzliche Urteil kein Rechtsmittel eingelegt habe.
Gegen dieses Urteil wendet sich die Beklagte mit der vom Bundesverwaltungsgericht wegen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtssache zugelassenen Revision und beantragt,unter Aufhebung des Urteils des Oberverwaltungsgerichts Berlin vom 15. Oktober 1976 und des Urteils des Verwaltungsgerichts Berlin vom 13. November 1974 die Klage abzuweisen.
Sie rügt Verletzung materiellen Rechts und macht im wesentlichen geltend: MüÃte der Dienstherr die der Beurteilung des Beamten zugrundeliegenden Tatsachen angeben, so griffe dies in den ihm für die Bildung eines Werturteils vorbehaltenen gerichtsfreien Raum ein. Zu einer solchen Darlegung sei die Behörde weder rechtlich verpflichtet noch tatsächlich in der Lage. Bewertungen, die nicht ausschlieÃlich auf einzelnen tatsächlichen Vorgängen beruhten, könnten und dürften hinsichtlich der ihnen zugrundeliegenden tatsächlichen Umstände vom Gericht nicht gewürdigt werden. Soweit sie sich - wie die hier streitigen Einzelurteile - auf Grund der höchstpersönlichen, aus vielfältigen Quellen gewonnenen Eindrücke des Beurteilenden gebildet hätten, seien sie durch Einzeltatsachen nicht zu belegen und deshalb einer nachvollziehenden Würdigung durch das Gericht, das dieselben Eindrücke nicht sammeln könne, von vornherein entzogen.
Der Kläger beantragt,die Revision zurückzuweisen.
Er führt im wesentlichen aus: Die Offenlegung der tatsächlichen Grundlagen einer dienstlichen Beurteilung im Streitfall sei notwendig, um den Anspruch des Beamten auf gerichtlichen Rechtsschutz in dem ohnehin durch die Beurteilungsermächtigung begrenzten Rahmen durchzusetzen. Das Verwaltungsgericht müsse in der Lage sein zu prüfen, ob negativen Urteilen ein wahrer "Tatsachenkern" zugrunde liege; der Beamte brauche sie nicht ohne eine "Durchleuchtung des Sachverhalts" hinzunehmen. Dabei dürfe die Intensität des Rechtsschutzes nicht davon abhängen, wie die dienstliche Beurteilung aufgebaut und formuliert sei, d.h. ob der Beurteilende mit seinen Bewertungen ausdrücklich an bestimmte tatsächliche Vorkommnisse anknüpfe oder ob seinen pauschalen Werturteilen eine unbestimmbare Vielzahl von Beobachtungen zugrunde liege. Es müÃten jedenfalls beispielhaft Tatsachen genannt werden, die eine bestimmte Bewertung begründen könnten. Hierdurch werde in das Zustandekommen des eigentlichen Werturteils als einer SchluÃfolgerung aus Tatsachen nicht unzulässig eingegriffen.
Der Oberbundesanwalt beteiligt sich am Verfahren. Er weist insbesondere darauf hin, daà der Dienstherr zwar die Berechtigung der in einer dienstlichen Beurteilung enthaltenen Werturteile darlegen müsse, daà aber der Vollzug der vom Berufungsgericht aufgestellten Forderung letztlich ein dauerndes "Leistungsfeststellungsverfahren" mit unangemessenem Verwaltungsaufwand und unvertretbaren nachteiligen Auswirkungen auf eine vertrauensvolle und effiziente Zusammenarbeit erforderlich machen würde.
II.Die zulässige Revision der Beklagten ist begründet. Sie führt zur Aufhebung des angefochtenen Urteils und zur Zurückverweisung der Sache an die Vorinstanz.
1.Dienstliche Beurteilungen sind nach der ständigen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts von den Verwaltungsgerichten nur beschränkt nachprüfbar (BVerwGE 21, 127 [129 f.]; Urteile vom 23. November 1966 - BVerwG 6 C 94.63 - [Buchholz 232 § 8 BBG Nr. 3], vom 21. März 1969 - BVerwG 6 C 114.65 - [Buchholz 237.1 Art. 12 BayBG 60 Nr. 1] und vom 17. Mai 1979 - BVerwG 2 C 4.78 - [Buchholz 232 § 8 BBG Nr. 14]; Beschluà vom 22. Januar 1974 - BVerwG 6 B 79.73 - [Buchholz 232 § 90 BBG Nr. 17]). Nur der Dienstherr oder der für ihn handelnde jeweilige Vorgesetzte soll nach dem erkennbaren Sinn der Regelungen über die dienstliche Beurteilung (hier: §§ 34, 35 der Verordnung über die Laufbahn der Bundesbeamten - Bundeslaufbahnverordnung - [BLV] vom 27. April 1970 [BGBl. I S. 422] - §§ 40, 41 Abs. 1 u. 2 der Bundeslaufbahnverordnung vom 15. November 1978 [BGBl. I S. 1763]) ein persönlichkeitsbedingtes Werturteil darüber abgeben, ob und inwieweit der Beamte den - ebenfalls vom Dienstherrn zu bestimmenden - zahlreichen fachlichen und persönlichen Anforderungen des konkreten Amtes und der Laufbahn entspricht. Bei einem derartigen dem Dienstherrn vorbehaltenen Akt wertender Erkenntnis steht diesem eine der gesetzlichen Regelung immanente Beurteilungsermächtigung zu. Ihr gegenüber hat sich die verwaltungsgerichtliche RechtmäÃigkeitskontrolle darauf zu beschränken, ob die Verwaltung den anzuwendenden Begriff oder den gesetzlichen Rahmen, in dem sie sich frei bewegen kann, verkannt hat oder ob sie von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist, allgemein gültige WertmaÃstäbe nicht beachtet oder sachfremde Erwägungen angestellt oder gegen Verfahrensvorschriften verstoÃen hat. Die verwaltungsgerichtliche Nachprüfung kann dagegen nicht dazu fuhren, daà das Gericht die fachliche und persönliche Beurteilung des Klägers durch seinen Dienstvorgesetzten in vollem Umfang nachvollzieht oder diese gar durch eine eigene Beurteilung ersetzt.
Im vorliegenden Fall bedarf in Sonderheit näherer Untersuchung, inwieweit dienstlichen Beurteilungen der beweismäÃigen Prüfung durch die Gerichte zugängliche Sachverhalte im Sinne der angeführten Rechtsprechung zugrunde liegen und inwieweit - unabhängig davon - dienstliche Beurteilungen im Streitfall nachvollziehbar und dadurch gerichtlich nachprüfbar gemacht werden müssen.
2.Innerhalb des in §§ 34, 35 BLV 1970 (= §§ 40, 41 Abs. 1 und 2 BLV 1978) gezogenen Rahmens unterliegt es grundsätzlich dem pflichtgemäÃen Ermessen des Dienstherrn, wie er die ihm aufgegebene, für zukünftige Personalentscheidungen verwertbare Aussage zu den einzelnen Beurteilungsmerkmalen gestalten und begründen und worauf er im einzelnen sein Gesamturteil über den Beamten und seinen Vorschlag für dessen weitere dienstliche Verwendung stützen will. Tatsächliche Grundlagen, auf denen Werturteile beruhen, sind nicht notwendig in die dienstliche Beurteilung aufzunehmen (vgl. dazu auch Urteil vom 16. Oktober 1967 - BVerwG 6 C 44.64 - [Buchholz 232 § 15 BBG Nr. 1]; VGH Mannheim NJW 1973, 75 [76]). Der Dienstherr kann einerseits einzelne Tatsachen oder Vorkommnisse im Beurteilungszeitraum aufgreifen und aus ihnen wertende SchluÃfolgerungen ziehen, wenn er sie etwa zur Charakterisierung des Beamten für besonders typisch hält oder für eine überzeugende Aussage zu einzelnen Beurteilungsmerkmalen für wesentlich erachtet. Er kann sich andererseits aber auch auf die Angabe zusammenfassender Werturteile auf Grund einer unbestimmten Vielzahl nicht benannter Einzeleindrücke und -beobachtungen während des Beurteilungsspielraumes beschränken. SchlieÃlich kann er die aufgezeigten verschiedenen Möglichkeiten, über Eignung und Leistung des Beamten ein aussagekräftiges, auch für Dritte verständliches Urteil abzugeben, in abgestufter Form nebeneinander verwenden bzw. miteinander verbinden. Alle diese Gestaltungsformen einer dienstlichen Beurteilung halten sich in dem von den Laufbahnvorschriften vorgezeichneten rechtlichen Rahmen. Auch die im vorliegenden Fall einschlägigen, durch Erlaà des Bundesministers der Finanzen vom 12. September 1973 eingeführten Richtlinien für die Beurteilung der Beamten der Zollverwaltung, der Bundesmonopolverwaltung für Branntwein, der Bundesvermögensverwaltung und der Sondervermögens- und Bauverwaltung Berlin (MinBlFin 1973 S. 394) schränken die Freiheit des Dienstherrn bei der inhaltlichen Gestaltung der dienstlichen Beurteilung nicht ein.
3.Die verschiedene Art und Weise, in der dienstliche Beurteilungen inhaltlich gestaltet und abgefaÃt werden können, wirkt sich auf ihre gerichtliche Ãberprüfung insofern aus, als vom beklagten Dienstherrn die ihm obliegende Darlegung, daà er von einem "richtigen Sachverhalt" ausgegangen ist, in einer der jeweiligen konkreten dienstlichen Beurteilung angepaÃten, mithin ebenfalls verschiedenartigen Weise zu fordern ist. Der das angefochtene Urteil tragende Rechtssatz, daà der Dienstherr im Streitfall verpflichtet sei, die Berechtigung einer von ihm erstellten dienstlichen Beurteilung durch Offenbarung der der Beurteilung zugrunde liegenden Tatsachen darzulegen und unter Beweis zu stellen findet in der allgemeinen und umfassenden Tragweite, wie ihn das Berufungsgericht zugrunde gelegt und auf den vorliegenden Fall angewendet hat, im geltenden Recht keine Stütze. Der dem Beamten durch Art. 19 Abs. 4 GG garantierte effektive Rechtsschutz gegen fehlerhafte dienstliche Beurteilungen wird in einer differenzierteren, den beiderseitigen Belangen Rechnung tragenden Weise sichergestellt.
a)Soweit der Dienstherr entweder historische Einzelvorgänge aus dem gesamten dienstlichen (und auÃerdienstlichen) Verhalten des Beamten ausdrücklich in der dienstlichen Beurteilung erwähnt oder die dienstliche Beurteilung bzw. einzelne in ihr enthaltene wertende SchluÃfolgerungen - nach dem Gehalt der jeweiligen Aussage erkennbar - auf bestimmte Tatsachen, insbesondere auf konkrete aus dem Gesamtverhalten im Beurteilungszeitraum herausgelöste Einzelvorkommnisse gründet, muà er im Streitfall diese Tatsachen darlegen und trägt das Risiko ihres Beweises. Auch unter der Form eines Urteils kann sich die Behauptung einer Tatsache verbergen, wenn die ÃuÃerung auf bestimmte nachprüfbare Handlungen oder Vorkommnisse in äuÃerlich erkennbarer Weise Bezug nimmt oder eine innere Tatsache so deutlich zum Ausgang nimmt bzw. umschreibt, daà auch ein nichtunterrichteter Dritter nicht nur die SchluÃfolgerung mitvollziehen, sondern auch die der Wertung zugrundeliegende Tatsache erkennen kann, kurz: wenn etwas "Greifbares" hinter dem Urteil steht (vgl. Schönke-Schröder, StGB, 20. Aufl. [1980], § 186, RdNr. 4; RGSt 68, 120 [121]; BGHZ 3, 271 [273 f.]; BGHSt 12, 287 [291]). Auch andere Werturteile können sich im Einzelfall auf bestimmte Tatsachen gründen. Soweit eine dienstliche Beurteilung bzw. ein in ihr enthaltenes Einzelurteil dergestalt einen "Tatsachenkern" enthält, gehört dieser zu dem "Sachverhalt" im Sinne des Urteils des erkennenden Senats vom 13. Mai 1965 (BVerwGE 21, 127 [130]), den das vom beurteilten Beamten angerufene Verwaltungsgericht auf seine Richtigkeit (Wahrheit) zu überprüfen hat.
b)Den Gegensatz hierzu bilden - bei allerdings im Einzelfall oft schwer zu bestimmender Grenze - die (reinen) Werturteile, die nicht auf konkreten einzelnen Vorgängen beruhen und die auch aus dem Zusammenhang der Aussage nicht in einer der beweismäÃigen Prüfung zugänglichen Weise erkennen lassen, auf welcher bestimmten Tatsachengrundlage sie beruhen (vgl. Schönke-Schröder, a.a.O.; BGHZ 3, 271 [273]; BGHSt 12, 287 [292] vgl. zur Abgrenzung auch BVerwGE 38, 336 [342 f.]). Allerdings gehen auch sie letztlich in ihrem Ursprung immer auf Tatsachen zurück. Denn Grundlage und Ausgangspunkt jedes Werturteils des Dienstherrn über den Beamten ist dessen dienstliches (und auÃerdienstliches) Verhalten. Auf dieser Tatsachenbasis baut jede dienstliche Beurteilung auf. Verhalten und Leistungen des Beamten gehen in diesen Fällen in die dienstliche Beurteilung aber nur über die Beobachtungen und Eindrücke ein, welche die beurteilenden Beamten von dem für die Beurteilung maÃgeblichen Verhalten des Beamten im Beurteilungszeitraum sammeln. Schon in dieser Phase, in der der Dienstvorgesetzte selbst oder durch Beauftragte die Grundlagen für die Beurteilung feststellt, und nicht erst bei der daran anschlieÃenden Zusammenfassung und Umsetzung des gesammelten Materials in wertende Urteile wirkt sich die dem Dienstherrn eingeräumte Beurteilungsermächtigung (BVerwGE 21, 127 [130]) aus: Zum einen sind Eindrücke, die jemand über einen längeren Zeitraum hinweg vom Verhalten eines anderen gewinnt, stets und notwendigerweise persönlichkeitsbedingt und von auÃenstehenden Dritten so nicht nachvollziehbar. Darüber hinaus ist es gerade die von der Rechtsordnung dem Dienstherrn anvertraute Aufgabe, aus der unbestimmten Fülle von Einzeltatsachen (Vorkommnissen, Verhaltensweisen und Erscheinungen), die sich in bezug auf den zu beurteilenden Beamten im Laufe eines Beurteilungszeitraumes ergeben, von vornherein gemäà den in eigener Verantwortung bestimmten Anforderungen des konkreten Amtes und der Laufbahn und den aufgestellten WertmaÃstäben diejenigen Einzeleindrücke und -beobachtungen auszuwählen, die nach seiner Auffassung für die ihm obliegende wertende Stellungnahme zu den Beurteilungsmerkmalen Gewicht und Aussagekraft besitzen (vgl. auch Schröder/Lemhöfer/Krafft, Das Laufbahnrecht der Bundesbeamten [1979], §§ 40, 41 BLV, RdNr. 5).
Hieraus folgt: Sind Gegenstand der verwaltungsgerichtlichen Prüfung auf einer Vielzahl von Eindrücken und Beobachtungen beruhende (reine) Werturteile des Dienstherrn über den Beamten in dem oben bezeichneten Sinne, so kann das Verwaltungsgericht nicht die Darlegung und den Nachweis der einzelnen "Tatsachen" verlangen, die diesen Werturteilen in ihrem Ursprung auch zugrunde liegen, in ihnen selbst aber - entsprechend der dem Dienstherrn insoweit zustehenden Gestaltungsfreiheit - nicht in bestimmbarer, dem Beweis zugänglicher Weise enthalten sind. Ein solches Verlangen lieÃe auÃer acht, daà die einem Werturteil zugrundeliegenden einzelnen tatsächlichen Vorgänge in der - zusammenfassenden und wertenden - persönlichen Beobachtung des Urteilenden verschmolzen und als solche nicht mehr feststellbar sind. Es griffe auch in die der gesetzlichen Regelung immanente Beurteilungsermächtigung der wertenden Behörde ein. Dies träfe insbesondere dann zu, wenn man dem Dienstherrn auferlegte, er müsse jedenfalls beispielhaft Vorgänge benennen, welche die abgegebenen Werturteile stutzen könnten. Denn hierdurch könnten Einzelereignisse, die für das Werturteil ohne selbständig-prägendes Gewicht waren, nachträglich eine Bedeutung gewinnen, die ihnen in Wahrheit nach der wertenden Erkenntnis des Dienstherrn nicht zukommen sollte (vgl. Schröder/Lemhöfer/Krafft, a.a.O.). Hiervon abgesehen müÃte eine den Anforderungen des Berufungsgerichts entsprechende gerichtliche Ãberprüfung von (reinen) Werturteilen des Dienstherrn über den Beamten letztlich an unüberwindlichen praktischen Hindernissen scheitern. Hierauf hat der Oberbundesanwalt zu Recht hingewiesen. Die Behörde müÃte nämlich, um im Streitfall ihr Werturteil durch Darlegung von "Tatsachen" rechtfertigen zu können, während des gesamten Beurteilungszeitraumes ständig solche Einzelbeobachtungen und -vorgänge, die für die spätere Beurteilung erheblich werden könnten, festhalten und hierüber schriftliche Aufzeichnungen anlegen (vgl. OVG Münster, ZBR 1975, 90 [91]). Um einem künftigen Streit über die Vollständigkeit dieser "Materialsammlung" vorzubeugen, wäre es zumindest angezeigt, daà der Dienstherr dem Beamten schon während des Beurteilungszeitraumes laufend bekannt gibt, welche "Tatsachen" er festgehalten hat, weil er sie für eine spätere Beurteilung für wesentlich hält. Ein solches dauerndes "Leistungsfeststellungsverfahren" hätte einen gänzlich unangemessenen und unvertretbaren Verwaltungsaufwand zur Folge. Es müÃte darüber hinaus auch das gegenseitige Vertrauensverhältnis zwischen Beamten und Dienstherrn in einer der sachgerechten Aufgabenerfüllung abträglichen Weise erschüttern, ohne daà hierdurch zugleich eine mit Sicherheit vollständige und zuverlässige "Tatsachenbasis" für zutreffende, jedem Streit oder Zweifel entzogene dienstliche Beurteilungen gewonnen werden könnte.
Ist einerseits der Dienstherr hiernach nicht gehalten, für ein (reines) Werturteil, das auf eine Vielzahl von persönlichen Eindrücken vom Charakter, vom Auftreten und der Arbeitsweise des Beamten gegründet ist, sämtliche während des Beurteilungszeitraumes gemachten Wahrnehmungen im einzelnen zu registrieren und - spätestens - in einem Streitfall offenzulegen (vgl. OVG Münster, a.a.O.; so auch WeiÃ/Niedermaier/Summer/Zängl, Bayerisches Beamtengesetz, Art. 118 Anm. 6), so braucht andererseits der Beamte solche für sein berufliches Fortkommen wesentlichen Werturteile, sofern sie fehlerhaft sind und ihn deshalb in seinen Rechten verletzen, nicht widerspruchslos und ohne wirksame Abhilfe hinzunehmen. Schon die dienstliche Beurteilung selbst muà in einer die gerichtliche Nachprüfung ermöglichenden Weise klar abgefaÃt werden (vgl. Beschlüsse vom 22. Januar 1974 - BVerwG 6 B 79.73 - [Buchholz 232 § 90 BBG Nr. 17] und vom 9. Januar 1978 - BVerwG 2 B 16.77 -). Die in § 34 Abs. 1 Satz 2 BLV 1970 (= § 40 Abs. 1 Satz 2 BLV 1978) vorgeschriebene Eröffnung und Besprechung der dienstlichen Beurteilung gibt dem Dienstherrn Gelegenheit, dem Beamten die Ergebnisse der dienstlichen Beurteilung sowie einzelne Werturteile und ihre Grundlagen näher zu erläutern. Hält der Beamte die Beurteilung oder einzelne in ihr enthaltene Werturteile auch danach noch für sachlich nicht gerechtfertigt, so kann er (durch Einlegen des Widerspruchs) die Beseitigung oder Ãnderung der Beurteilung oder die Vornahme einer neuen Beurteilung beantragen. Auch in diesem der Anrufung der Verwaltungsgerichte zwingend vorgeschalteten (§ 126 Abs. 3 BRRG) Verwaltungsverfahren wird der Dienstherr gegebenenfalls allgemeine und pauschal formulierte Werturteile durch weitere nähere (schriftliche) Darlegungen zu erläutern, zu konkretisieren und dadurch plausibel zu machen haben. Dies kann durch Anführung von tatsächlichen Vorgängen, aber auch von weiteren (Teil-)Werturteilen erfolgen. Entscheidend ist, daà das Werturteil keine formelhafte Behauptung bleibt, sondern daà es für den Beamten einsichtig und für auÃenstehende Dritte nachvollziehbar wird, daà der Beamte die Gründe und Argumente des Dienstherrn erfährt und für ihn der Weg, der zu dem Urteil geführt hat, sichtbar wird. Der Beamte hat hierauf Anspruch, weil er nur so beurteilen kann, ob er mit Aussicht auf Erfolg gegen ihn nachteilige wertende Urteile seines Dienstherrn um gerichtlichen Rechtsschutz nachsuchen kann (vgl. BVerfGE 6, 32 [44]; BVerwGE 22, 215 [217 f.]; 38, 191 [194]; Wolff-Bachof, Verwaltungsrecht I, 9. Aufl. [1974], § 50 II d 2 [S. 420]; Badura in Erichsen/Martens, Allgemeines Verwaltungsrecht, 3. Aufl. [1978], § 41 II 3 [S. 307]). Das Verwaltungsgericht kann nur auf der Grundlage solcher Erläuterungen und Konkretisierungen nachprüfen, ob der Dienstherr bei der Abgabe der dienstlichen Beurteilung bzw. einzelner in ihr enthaltener Werturteile von einem unrichtigen Sachverhalt ausgegangen ist oder allgemein gültige WertmaÃstäbe verletzt hat. Macht der Dienstherr in der geschilderten Weise seine Werturteile plausibel und nachvollziehbar, so wird dadurch dem Anspruch des Beamten auf effektiven gerichtlichen Rechtsschutz (Art. 19 Abs. 4 GG) in einem ausreichenden und zugleich praktikablen, d.h. eine Ãberforderung des Dienstherrn vermeidenden Umfang genügt.
Hat der Dienstherr auch in dem Verwaltungsverfahren allgemein gehaltene Werturteile nicht oder nicht ausreichend erläutert, so bestehen grundsätzlich keine Bedenken, daà er dies noch im Verwaltungsstreitverfahren nachholt (vgl. Urteil vom 7. November 1962 - BVerwG 6 C 144.61 - [Buchholz 232 § 32 BBG Nr. 6]; Beschluà vom 11. April 1975 - BVerwG 6 B 73.74 -). Die Beurteilung selbst bzw. das einzelne vom Beamten angegriffene Werturteil wird durch die nachträgliche Darlegung und Erläuterung der maÃgeblichen Erwägungen des Dienstherrn nicht inhaltlich geändert und der Beamte in aller Regel in der Wahrung seiner Rechte nicht beeinträchtigt (vgl. zum Nachschieben von Gründen für einen angefochtenen Verwaltungsakt BVerwGE 10, 37 [44]; 19, 252 [257]; 38, 191 [194 f.]). In besonders gelagerten Einzelfällen kann Anlaà bestehen, dem beklagten Dienstherrn, auch wenn er obsiegt, gemäà § 155 Abs. 5 VwGO die Kosten des Verwaltungsstreitverfahrens aufzuerlegen.
4.Das vorinstanzliche Urteil wird - ebenso wie schon das Urteil des Verwaltungsgerichts - dem hiernach rechtlich gebotenen differenzierten MaÃstab für die gerichtliche Prüfung von dienstlichen Beurteilungen nicht gerecht. Es hat die Beklagte unter Aufhebung der ablehnenden Bescheide zur Erstellung einer neuen Beurteilung über den Kläger verpflichtet, weil sie entgegen ihrer - vom Berufungsgericht unterschiedslos für jede dienstliche Beurteilung bejahten - Verpflichtung, im Streitfall zugrundeliegende Tatsachen zu offenbaren, für die Einzelbeurteilungen III/3 und III/7 sowie die zusammenfassende Beurteilung IV keinen im einzelnen nachprüfbaren Sachverhalt vorgetragen habe, der diese Beurteilungen rechtfertigen könnte. Dabei hat das Berufungsgericht auÃer acht gelassen, daà die von ihm geprüften und beanstandeten Teile der dienstlichen Beurteilung vom 1. November 1973 - ebenso übrigens auch die anderen, von ihm nicht überprüften Einzelbeurteilungen - reine Werturteile ohne erkennbare, der beweismäÃigen Prüfung zugängliche bestimmte Tatsachengrundlagen sein können. Weder die Aussage, daà der Vortrag des Klägers "mitunter stockend, aber dennoch verständlich" sei und daà der Kläger "als Verhandlungsleiter bedingt geeignet" sei, noch die Feststellung, daà der Kläger sich als Vorgesetzter "nicht uneingeschränkt bewährt" habe noch die in die zusammenfassende Beurteilung aufgenommene Bemerkung, dem Kläger fiele es leichter, seine Aufgaben unbeanstandet zu erfüllen, "wenn er den dienstlichen Belangen gegenüber eine etwas aufgeschlossenere Einstellung finden könnte", gründen sich notwendig auf konkrete, aus dem Gesamtverhalten im Beurteilungszeitraum herausgelöste Einzelvorkommnisse. Dies hat - wie dargelegt - zur Folge, daà von der Beklagten auch im Streitfall zur Rechtfertigung ihrer dienstlichen Beurteilung insoweit nicht die Darlegung von bestimmten Tatsachen gefordert werden kann. Die das Berufungsurteil tragende Begründung erweist sich mithin als rechtsfehlerhaft. Da die angefochtene Entscheidung sich auch nicht aus anderen Gründen als im Ergebnis richtig darstellt, ist sie aufzuheben.
Für eine abschlieÃende Entscheidung über den Klageantrag bedarf es weiterer Aufklärung. Sowohl der Bescheid der Beklagten vom 18. Januar 1974 als auch ihr Widerspruchsbescheid vom 21. März 1974 enthalten lediglich allgemeine Ausführungen, aber keinerlei auf die einzelnen Werturteile eingehende Erläuterungen, welche die gegen den Kläger erhobenen Beanstandungen in dem oben aufgezeigten Sinne "plausibel" erscheinen lassen könnten. Auch der vom Berufungsgericht als wahr unterstellte Vortrag der Beklagten, der die Beurteilung entwerfende Beamte habe die Werturteile auf Grund seiner Eindrücke, die mit denen der früheren Vorgesetzten des Klägers übereinstimmten, nach bestem Wissen und Gewissen abgegeben, liefert keinen greifbaren Anhalt für eine gerichtliche Prüfung. Das Berufungsgericht hat - von seinem Rechtsstandpunkt aus folgerichtig - unterlassen, die Beklagte zu der erforderlichen und noch im Verwaltungsstreitverfahren nachholbaren Konkretisierung ihrer Werturteile über den Kläger zu veranlassen. Da das Revisionsgericht diese notwendigen Feststellungen nicht selbst treffen darf, ist die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung an die Vorinstanz zurückzuverweisen.