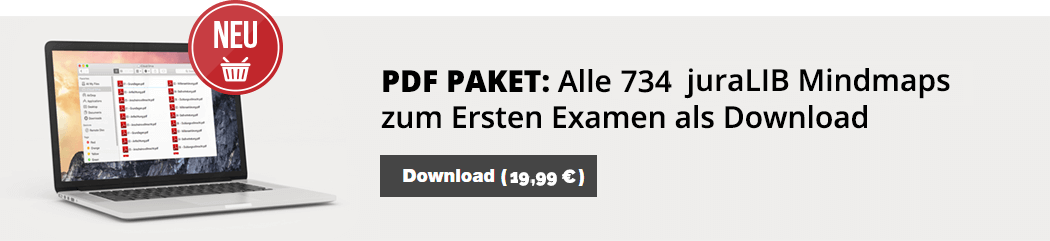Bundesverwaltungsgericht
Entscheidung vom 29.08.1963, Az.: VIII C 248/63
Tenor
Die Revision des Klägers gegen das Urteil des Oberverwaltungsgerichts für das Land Nordrhein-Westfalen vom 27. November 1961 wird zurückgewiesen.
Der Kläger trägt die Kosten des Revisionsverfahrens.
Entscheidungsgründe
I.Der im Jahre 1888 geborene Kläger studierte Sprachen und Volkswirtschaft und promovierte im Jahre 1913. Im April 1914 wurde er Geschäftsführer und Syndikus des Innungsausschusses ..., im Jahre 1918 übernahm er auch die Geschäftsführung des Vereins Mittelstandshaus ... e.V. Er war politisch tätig in der Zentrumspartei. Sein Gehalt bei dem Innungsausschuà wurde im Zuge der Neuorganisation des Handwerks - Gesetz vom 15. Juni 1934, RGBl. I S. 493 - herabgesetzt von 784 RM auf 500 RM. Am 1. Juni 1935 wurde die Geschäftsführung der Kreishandwerkerschaft ... - der Rechtsnachfolgerin des Innungsausschusses - von der Geschäftsführung des Vereins Mittelstandshaus gelöst; dessen tatsächliche Geschäftsführung, die der Kläger nominell behielt, übernahm ein anderer. Am 1. April 1937 wurde dem Kläger zum 30. Juni 1937 gekündigt. Auf Grund eines Einspruchs blieb er zunächst tätig. Er wurde aber am 31. Dezember 1937 fristlos entlassen. Eine Entscheidung im anschlieÃenden arbeitsgerichtlichen Verfahren erging nicht. AnschlieÃend war der Kläger freiberuflich tätig. Eine arbeitsgerichtliche Klage, die er im Jahre 1949 gegen die Kreishandwerkerschaft ... und den Verein Mittelstandshaus ... mit dem Ziel einer Nachzahlung erhob, führte zu einem Urteil, durch das - unter Klagabweisung im übrigen - die Beklagten als Gesamtschuldner zur Zahlung von 1.590,40 DM verurteilt wurden. Im anschlieÃenden Verfahren vor dem Landesarbeitsgericht schlossen die Parteien im Oktober 1950 einen Vergleich, der im wesentlichen der erstinstanzlichen Entscheidung entsprach.
Im Jahre 1956 wurde dem Kläger eine Entschädigung nach dem Bundesentschädigungsgesetz - BEG - vom 29. Juni 1956 (BGBl. I S. 562) zugesprochen. Sein Antrag, ihm wegen eines Schadens im öffentlichen Dienst Wiedergutmachung zu gewähren, wurde seitens der Beklagten abgelehnt. Mit der Klage verfolgte er den Anspruch auf "Wiedergutmachung nach dem BWGöD". Die Klage würde abgewiesen. Der Kläger legte Berufung ein und begründete diese im wesentlichen wie folgt: Als ihm 1925 ein anderer Posten angeboten worden sei, habe ihm der Vorsitzende des Innungsausschusses, um ihn ... zu halten, die finanzielle und versorgungsrechtliche Gleichstellung mit den Geschäftsführern der Handwerkskammer zugesichert. Das Versprechen sei eingelöst worden, als er 1932 auf Lebenszeit eingestellt worden sei. Damals habe er die Zusage erhalten, ab 1. April 1933 in die ... Ruhegehaltskasse eingekauft zu werden. Sein Fall sei ein besonderer gewesen; es komme nicht darauf an, ob andere Geschäftsführer einer Kreishandwerkerschaft im Kammerbezirk ... in die Ruhegehaltskasse eingekauft worden seien. Die Lage der ... Kreishandwerkerschaft sei nicht besonders ungünstig gewesen. Die Berufung wurde zurückgewiesen, im wesentlichen aus den folgenden Gründen:
Es sei davon aus zugehen, daà die Entlassung überwiegend auf politischen Verfolgungsgründen beruht habe. Der Kläger sei aber nicht versorgungsberechtigt; er gehöre nicht zu den Angestellten, die einen vertraglichen Anspruch auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen gehabt haben oder ohne die Schädigung erreicht haben würden: Ob er 1932 einen schriftlichen Anstellungsvertrag auf Lebenszeit erhalten habe, sei zweifelhaft, bedürfe aber keiner Klärung. Hätte ein solcher Vertrag bestanden, so ergäbe sich daraus allein noch keine Versorgungsberechtigung im Sinne von § 21 Abs. 1 BWGöD. Der Zeuge ... L... der schriftlich erklärt habe, der Kläger habe einen Anstellungsvertrag auf Lebenszeit gehabt, in dem die Zahlung eines Ruhegehalts vorgesehen gewesen sei, habe sich bei seiner Vernehmung an die Formulierungen des Vertrages nicht mehr erinnern können. Selbst wenn dem Kläger geglaubt werde, ihm sei die behauptete Zusage gemacht worden, liege darin noch nicht ein vertraglicher Anspruch auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen. Die vertragliche Verpflichtung habe nach dem eigenen Vortrag des Klägers erst mit dem in Aussicht genommenen Einkauf bei den ... Versorgungskassen verwirklicht werden sollen. Auch ohne die Schädigung hätte der Kläger mit überwiegender Wahrscheinlichkeit einen solchen Anspruch nicht erlangt. Drei schriftliche Stellungnahmen amtlicher Stellen sprächen dagegen.
Die Revision wurde vom Bundesverwaltungsgericht im Beschwerdeverfahren zugelassen.
Mit seiner Revision verfolgt der Kläger seinen Klaganspruch. Er rügt die Verletzung formellen und des materiellen Rechts. Die Beklagte beantragt, die Revision zurückzuweisen.
II.Die Revision ist unbegründet.
Die Beklagte ist ein öffentlicher Dienstherr im Sinne von §§ 1 Abs. 1, 2 a des Gesetzes zur Regelung der Wiedergutmachung nationalsozialistischen Unrechts für Angehörige des öffentlichen Dienstes - BWGöD -, jetzt geltend in der Fassung vom 24. August 1961 (BGBl. I S. 1627) in Verbindung mit Nr. 4 der Anlage I der letztgenannten Vorschrift. Der Kläger war bei ihr angestellt, als er zum 31. Dezember 1937 fristlos entlassen wurde. Als Angestellter des öffentlichen Dienstes (§ 2 Abs. 1 Nr. 1 BWGöD) ist er geschädigt worden im Sinne von §§ 1 Abs. 1, 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. a BWGöD in Verbindung mit § 1 BEG. Da seine bevorzugte Wiederanstellung (§§ 21, 9 BWGöD) nicht mehr möglich ist, kommt nur ein Versorgungsanspruch nach § 21 Abs. 1 in Verbindung mit dem entsprechend anzuwendenden § 11 Abs. 1 BWGöD in Betracht. Voraussetzung ist, daà der Kläger zu den Angestellten des öffentlichen Dienstes gehörte, die einen vertraglichen Anspruch auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen hatten oder ohne die Schädigung erreicht haben würden.
Der Begriff der Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen ist im Urteil vom 7. Dezember 1961 - BVerwG VIII C 503.59 - wie folgt bestimmt worden:"Der im Bundeswiedergutmachungsgesetz verwendete Begriff 'Versorgung' meint Versorgung auf Lebenszeit einschlieÃlich Hinterbliebenenversorgung (Urteil vom 23. November 1961 - BVerwG VIII C 249.59 -). 'Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen' ist von der Versorgung nach Grundsätzen der Sozialversicherung, der Privatversicherung und von jeder sonstigen Versorgung zu unterscheiden, die nicht nach den überkommenen Grundsätzen des Beamtenrechts gewährt und bemessen wird. In § 79 des Deutschen Beamtengesetzes vom 26. Januar 1937 (RGBl. I S. 39), der unberührt von nationalsozialistischem Gedankengut ist und auf frühere Beamtengesetze zurückgeht, und in § 107 des Bundesbeamtengesetzes in der Fassung vom 18. September 1957 (BGBl. I S. 1338) wird der Begriff der Beamtenversorgung - auf das Ruhegehalt bezogen - dadurch bestimmt, daà das Ruhegehalt auf der Grundlage der ruhegehaltfähigen Dienstbezüge und der ruhegehaltfähigen Dienstzeit berechnet wird; diese Begriffsbestimmung ist auch bei der Anwendung von § 21 Abs. 1 BWGöD maÃgebend (vgl. Anders, BWGÃD, 2. Aufl., Anm. 2 zu § 21)."
Das Berufungsgericht hat das Vorliegen dieser Voraussetzungen ohne materiellrechtliche Fehler verneint. Es ist dabei von dem eigenen Vorbringen des Klägers ausgegangen. Der Kläger hat nicht behauptet, er habe zur Zeit seiner Entlassung einen vertraglichen Anspruch auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen gehabt im Sinne der ersten Alternative von § 21 Abs. 1 BWGöD.
Das Berufungsgericht hat ferner geprüft, ob der Kläger ohne die Schädigung im Sinne der zweiten Alternative von § 21 Abs. 1 BWGöD im Verlauf seiner Dienstlaufbahn voraussichtlich versorgungsberechtigt nach beamtenrechtlichen Grundsätzen geworden wäre. Es hat - der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts folgend -§ 9 Abs. 2 Satz 1 BWGöD entsprechend angewendet und gefragt, ob die spätere Erlangung eines Anspruchs auf Versorgung nach beamtenrechtlichen Grundsätzen überwiegend wahrscheinlich gewesen wäre unter der Voraussetzung, es hätte an Verfolgungen gefehlt. Es hat keine Anhaltspunkte dafür gefunden, daà der Kläger, wenn er nicht entlassen worden wäre, später im angegebenen Sinn versorgungsberechtigt geworden wäre: Er habe nichts dafür vorgebracht, daà etwa sein Nachfolger oder gleichartige Geschäftsführer von Kreishandwerkerschaften versorgungsberechtigt geworden sind. Die Handwerkskammer in ... habe zum Ausdruck gebracht, es gebe keine Kreishandwerkerschaft im Regierungsbezirk ..., die solche Verpflichtungen übernommen habe; sie habe auch dargelegt, daà für eine solche Versorgungsregelung die erforderliche Zustimmung der Handwerkskammer nicht erteilt worden wäre. Der Landesminister für Wirtschaft und Verkehr habe schriftlich erklärt, in der Rheinprovinz sei nur die Kreishandwerkerschaft E... der Versorgungskasse für das Handwerk in D... angeschlossen gewesen, während auch heute keine Kreishandwerkerschaft des Bezirks A... der Versorgungskasse für das Handwerk angehöre. SchlieÃlich habe der Direktor des Landschaftsverbandes ... -. Versorgungskasse, Sonderkasse der Organisationen des Handwerks - schriftlich mitgeteilt, 45 Kreishandwerkerschaften aus dem Bundesgebiet seien Mitglied dieser Sonderkasse, also wenig mehr als 10 vom Hundert aller Kreishandwerkerschaften.
Im Wege der ihm obliegenden Beweiswürdigung hat das Berufungsgericht die Frage, ob der Kläger ohne Verfolgung voraussichtlich versorgungsberechtigt geworden wäre, ohne Rechtsirrtum verneint. Der Beweisnot des Klägers ist dadurch Rechnung getragen worden, daà das Berufungsgericht eine mit überwiegender Wahrscheinlichkeit zu treffende Feststellung für ausreichend gehalten, die Möglichkeit einer solchen Feststellung aber verneint hat. Auf die Frage, ob ein Versorgungsverhältnis bei der Versorgungskasse den Anforderungen des § 21 Abs. 1 BWGöD entsprochen hätte, kommt es nicht an.
Auf die Zusage einer späteren Gleichstellung mit den versorgungsberechtigten Geschäftsführern der Handwerkskammern, die der Kläger nach seiner Behauptung im Jahre 1925 erhalten hat, und auf die weitere Zusage, die er im Jahre 1932 erhalten haben will, er solle im April 1933 in eine Versorgungskasse eingekauft werden, kann es nach der zutreffenden Rechtsansicht des Berufungsgerichts nicht ankommen; durch solche Zusagen wird ein vertraglicher Versorgungsanspruch noch nicht begründet, solange aus ihnen keine im Versorgungsfall einen Versorgungsanspruch auslösende Anwartschaft erwächst. Die arbeitsrechtlichen Grundsätze, die das Berufungsgericht bei der Feststellung angewendet hat, der Kläger sei nach seinem eigenen Vorbringen Anfang 1933 noch nicht versorgungsberechtigt gewesen, unterliegen nicht der Prüfung im Revisionsverfahren (§ 137 Abs. 1 VwGO). Wurde eine bloÃe Zusage später aus politischen Gründen nicht eingehalten, so liegt darin noch keine zur Wiedergutmachung berechtigende Schädigung. Das ergibt sich aus den folgenden Erwägungen:
§ 5 BWGöD nennt abschlieÃend die Schädigungen, auf die ein Wiedergutmachungsanspruch gestützt werden kann. So wird in § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c BWGöD der Fall erwähnt, daà die Ãbernahme eines Angestellten in das Beamtenverhältnis abgelehnt wurde, obwohl die Voraussetzungen dafür nach rechtsstaatlichen Grundsätzen vorlagen. Eine groÃzügige Auslegung des § 5 BWGöD ist allerdings geboten; es ist aber nicht möglich, neue Schädigungstatbestände in das Gesetz einzuführen. Dahin hat das erkennende Gericht wiederholt entschieden. Entgegen der Ansicht von Anders (DVBl. 1963 S. 533 f.) fehlt eine gesetzliche Vorschrift, die es ermöglichen würde, eine Entschädigung anzuerkennen, wenn ein Angestellter entgegen einer früheren Zusage nicht versorgungsberechtigt nach beamtenrechtlichen Grundsätzen wurde. Die entsprechende Anwendung von § 5 Abs. 1 Nr. 3 Buchst. c BWGöD (Ablehnung der Ãbernahme in das Beamtenverhältnis) ist in einem solchen Falle nicht möglich.
In verfahrensrechtlicher Hinsicht rügt der Kläger zu Unrecht, er hätte als Partei vernommen werden müssen. Nach der Urteilsbegründung war dies schon deshalb nicht erforderlich, weil das Berufungsgericht von der Richtigkeit seiner Behauptungen, er sei auf Lebenszeit angestellt gewesen und habe im Jahre 1932 eine Versorgungszusage erhalten, ausgegangen ist.
Die auf § 86 Abs. 2 VwGO gestützte Revisionsrüge ist ebenfalls unbegründet. Danach ist über einen in der mündlichen Verhandlung gestellten Beweisantrag durch Gerichtsbeschluà zu entscheiden, der zu begründen ist, sofern der Antrag abgelehnt wird. Im Urteil BVerwGE 12, 268 [BVerwG 23.06.1961 - IV C 308/60] ist zu § 86 Abs. 2 VwGO entschieden worden, daà das Fehlen einer Begründung des Ablehnungsbeschlusses fehlerhaft ist. In dem nicht veröffentlichten Teil des Urteils wird dargelegt, daà der Mangel nur dann zur Zurückverweisung führt, wenn das Urteil auf dem Mangel beruht. Jenes Urteil betraf einen Fall, bei dem zugleich in anderer Weise gegen § 86 Abs. 2 VwGO verstoÃen worden war: Der Ablehnungsbeschluà war zugleich mit dem Urteil verkündet worden, ohne daà dem Antragsteller Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben wurde. Dem ProzeÃbevollmächtigten des Klägers wurde dagegen im vorliegenden Falle die Stellungnahme zum Ablehnungsbeschluà ermöglicht: Nach der Niederschrift über den Verlauf der mündlichen Verhandlung, deren Unrichtigkeit von der Revision nicht behauptet wird, hat der ProzeÃbevollmächtigte des Klägers in der letzten Berufungsverhandlung beantragt, "den Kläger als Partei zu vernehmen". Dieser Antrag wurde nach Beratung abgelehnt. Eine Stellungnahme zu dem Ablehnungsbeschluà war dem ProzeÃbevollmächtigten des Klägers noch vor der Urteilsverkündung möglich. Es handelte sich im übrigen nicht um einen echten Beweisantrag im Sinne von § 86 Abs. 2 VwGO. Dafür reicht die Angabe eines Beweismittels nicht aus; es muà auch angegeben werden, welche tatsächlichen Behauptungen "unter Beweis gestellt" werden. Bereits im genannten Urteil BVerwGE 12, 268 [BVerwG 23.06.1961 - IV C 308/60] [269] ist dargelegt worden, daà nur im Falle echter Beweisanträge§ 86 Abs. 2 VwGO anzuwenden ist. Daran fehlte es hier. Es war nicht zu erkennen, welche Behauptungen unter Beweis gestellt werden sollten. Unter diesen Umständen war es unschädlich, daà die Ablehnung des Antrages nicht mündlich begründet wurde.
Auf die Darlegungen der Revisionsbegründung, die dartun sollen, warum das Urteil auf dem gerügten Mangel - Verletzung von§ 86 Abs. 2 VwGO - beruht, kommt es nicht an.
Zu Unrecht rügt die Revision schlieÃlich, es sei eine Ãberraschungsentscheidung getroffen worden. Das ist schon deshalb nicht richtig, weil die Begründung des erstinstanzlichen Urteils im wesentlichen bestätigt worden ist.
Die Revision war daher mit der Kostenfolge des § 154 Abs. 2 VwGO zurückzuweisen.