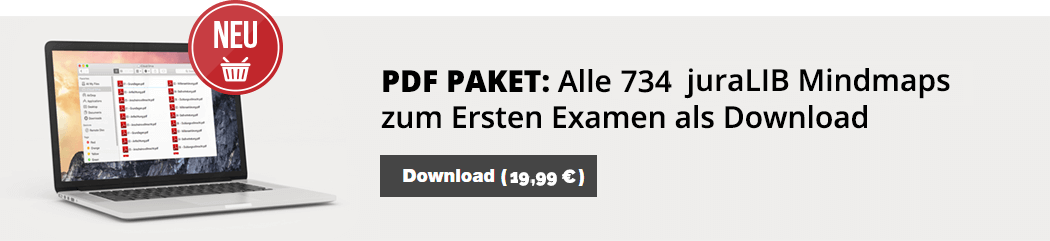10103
- § 437 Rechte des Käufers bei Mängeln
- Schema § 437: Voraussetzungen
- Kaufvertrag nach § 433 BGB Zwei übereinstimmende Willenserklärungen Antrag und Annahme
- Sachmangel nach § 434
- a) § 434 I S.1 Vereinbarte Beschaffenheit Die Norm legt den bisher von der h. M. vertretenen sog. subjektiven Fehlerbegriff zu Grunde, indem in erster Linie auf den Inhalt der getroffenen Vereinbarung abstellt wird. Betreibt der Verkäufer den Kaufgegenstand in Prospekten etc. so werden, wenn der Käufer vor diesem Hintergrund seine Kaufentcheidung trifft, die Erklärungenes Verkäufers ohne Weiteres zum Inhalt des Vertrages
- b) § 434 I S.2 Nr.1 nach dem Vertrag vorausgesetzte Verwendung eignet Die Sache soll für einen bestimmten Verwendungszweck tauglich sein.
- c) § 434 I S.2 Nr.2 Gewöhnliche Beschaffenheit oder Beschaffneheit einer Sache der gleichen Art üblich ist Hierbei geht es um einen objektiven Fehlerbegriff, für de es nicht auf die Vorstelung der Vertragsparteien, sondern auf diejenigen eines Durcschnittskäufers ankommt Zu § 434 I S.2 Ne.2 gehören auch Eigenschaften, die der Käufer nach öffentlichen Äußerungen des Verkäufers, Herstellrs oder seines Gehilfen insbesondere in der Werbung erwarten kann. (§ 434 I S.3) lex specialis.
- d) § 434 II S.1 Montagefehler Ein Sachmangel liegt auch dann vor wenn die vereinbarte Montage durch den Verkäufer oder dessen Efüllungsgehilfen unsachgemäß durchgeführt wurde. § 434 II S.2 Montageanleitung Ein Sachmangel liegt bei einer zur Montage bestimmten Sache auch dann vor, wenn die Montageanleitung mangelhaft ist, es sei den die Sche3 ist fehlerfrei montiert worden
- e) § 434 III Falsch oder Zuweniglieferung Es steht einem Sachmangel gleich wenn der Verkäufer eine andere Sache (aliud) oder eine zu geringe Menge ( Quantitätsmangel) liefert. -Eine zuweniglieferung liegt nur vor, wenn der Verkäufer aus Sicht des Käufers mit der Mindermenge seine ganze Verbindlichkeit erfüllen will -Eine als erkannte (offene( Zuweniglieferung einem Sachmnagel nicht gleich, der Käufer kann dies als unzulässige Teileistung zurückweisen (§ 266) -§ 434 III greift nicht ein wen der Käufer die Teillieferung erkennt und als solche annimmt.
- Sachmangel bereits bei Gefahrenübergang
- § 446 Gefahr- und Lastenübergang Die Gefahr (Preisgefahr) geht hier mit der Übergabe der verkauften Sache oder mit dem Annahmeverzug des Käufers auf diesen über
- § 447 Gefahrenübergang bei Versendungskauf Hier geht die gefahr auf den Käufer über wenn der Verkäufer die Sache auf Verlangen ees Käufers an die Transportperson ausgeliefert hat
- § 474 Verbrauchsgüterkauf (§ 13 Verbraucher, § 14 Unternehmer) Beim Verbrauchsgüterkauf ist § 476 zu beachten. Danach wird bei einem Schmangel der sich innerhalb von 6 Monaten seit Gefahrenübergang zeigt, kraft Gesetz vermutet, dass die Sache bereits bei Gefahrenübergang mangelhaft war. Eine Ausnahme gilt nur, enn diese Vermutung mit der Art der Sache oder des Mangels unvereinbar ist.
- Ausschluss der Gewährleistung/ Mängelrechte
- § 444 Haftungsausschluss durch vertragliche Vereinbarung Ausgeschlossen wenn: -Der Verkäufer den Mangel kennt und diesen arglisit Verschweigt -Übernahme einer Garantie/Beschaffenheitsgarantie: Nach § 276 I haftet der Schuldner acuh ohne Verschulden bei Garantie Nach § 443 Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie die gesetzliche Mängelhaftung des § 437 wird erweitert
- § 442 Ausschluss aufgrund Kenntnis des Käufers
- Ausschluss durch AGB
- Vorliegen von AGB § 305 I S.1
- Vorformuliert
- undefined
- Für eine Vielzahl von Verträgen Mindestens dreimalige Verwendung
- einseitig gestellt Der Verwender muss die Einezieung einseitig und diskussionslos veranlaßt haben 'take it or leave it'
- Einbeziehung
- gegü. Verbraucher § 305 II
- Ausdrücklicher Hinweis Dieser muss deutlich erkennbar sein: Wenn ABG auf der Rückseite -→ Hinweis auf der Vorderseite 'Dem Durchschnittskunden muss dies ins Auge springen'
- Möglichkeit zumutbarer Kenntnisnahme Bei Vertragsschluss unter Abwesenden sind AGB idR zu übersenden
- Einverständnis des Kunden (ausdrücklich oder konkludent) Möglich auch durch Annahme der Ware
- Ausnahmen: Individualabrede verdrängt AGB
- Kein Verstoß gegen das Verbot überraschender Klauseln (§ 305 c I BGB) Ein Überraschungseffekt ist gegeben, wenn nach den Umständen mit einer derartigen Klausel aus Sicht des typischen Abnehmerkreises nicht gerechnet werden musste. Erstens muss es sich um eine objektiv ungewöhnliche Bestimmung handeln. Zweitens muss der Bestimmung Überrumpelungscharakter innewohnen.
- gegenü. Unternehmer § 310 I 1, III Nr.3
- Inhaltskontrolle
- Schranken der Kontrollfähigkeit (§ 307 III BGB) Nach § 307 III BGB ist die Inhaltskontrolle von AGB nach den §§ 307-309 BGB beschränkt auf solche Bestimmungen, die inhaltlich von Rechtsvorschriften abweichen oder die gesetzliche Regelung ergänzen.
- Beispiel
- BeispielKlauselverbote mit Wertungsmöglichkeit (§ 308 BGB)
- Beispiel§ 307 II Da § 307 II BGB mit der Aufzählung von Regelbeispielen eine Konkretisierung des § 307 I BGB darstellt, indem in ihm eine widerlegbare gesetzliche Vermutung aufgestellt wird, wann eine unangemessene Benachteiligung vorliegt, ist dieser zuerst zu prüfen (i.e. strittig).
- Beispiel§ 307 I Die Generalklausel ist subsidiär. Sie findet keine Anwendung, wenn die fragliche Klausel von §§ 308, 309 BGB nicht erfasst oder nach dortiger Regelung, wie in unserem Fall gem. § 309 Nr. 1 BGB, zulässig ist.
- BeispielVerbot der geltungserhaltenden Reduktion Führt die Inhaltskontrolle zu dem Ergebnis, dass die fragliche Klausel unwirksam ist, so ist sie insgesamt nichtig. Es ist nicht zulässig, sie auf das zulässige Maß zu reduzieren (sog. Verbot der geltungserhaltenden Reduktion, vgl. dazu Larenz/Wolf, AT, 9. Aufl., § 43, Rn. 81 ff; strittig, aber Standpunkt der Rspr. und der wohl noch h.M.).
- Unwirksamkeit nach § 474
- Ausschluss aufgrund der handelsrechtlichen Genehmigungsfiktion nach § 377 II HGB
- Kaufmannsbegriff =
- Istkaufmann § 1,2 HGB Kaufmann ist, wer ein Handelsgewerbe betreibt. (1) Handelsgewerbe - Ausgeübte Tätigkeit muss ein Gewerbe darstellen; - Handelsgewerbe i.S.d. §§ 1 u. 2. (2) Das Handelsgewerbe muss betrieben werden. Betrieben wird es von demjenigen, der aus den abgeschlossenen Geschäften berechtigt und verpflichtet wird. Nicht: Freie Berufe; wissenschaftliche und künstlerische Tätigkeiten. Abgrenzung: Kleingewerbe.
- Kannkaufman § 3 HGB Grds. keine Kaufleute. Zum Kannkaufmann wird, wer (1) land- oder forstwirtschaftliches Unternehmen, (2) U. muss nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordern und (3) (freiwillige) Eintragung.
- Formkaufmann § 6 HGB Hierzu zählen: ? OHG, ? KG, ? GmbH, ? AG, ? KGa.A, ? Genossenschaft, ? EWIV.
- Kannkaufmann kraft Eintragung § 5 Auch eingetragene Nichtgewerbetreibende gelten als Kaufleute
- Wer im Rechtsverkehr wie ein Kaufmann auftritt, muss sich ggfs. gutgläubigen Dritten gegenüber an diesem Rechtsschein festhalten lassen.
- Beidseitiger Handelskauf Sowohl Käufer als auch Verkäufer müssen Kaufleute nach §§ 1ff. HGB sein. Für beide muss es sich bei dem Kaufvertrag um ein Handelsgeschäft gem. §§ 343, 344 HGB handeln.
- Ablieferung der Ware Die Ware muss so in den Herrschafts- und Wirkungsbereich des Käufers gelangt sein, dass er sie untersuchen kann.
- Mangel der Ware Es muss ein Mangel nach §§ 434, 435 vorliegen
- Verletzung der Rügepflicht § 377 II HGB Der Mangel müsste konkret aufgrund einer Untersuchung unverzüglich angezeigt werden
- Kein arglistiges Verschweigen des Magels § 377 V HGB
- Bei Zwischenhändlern die die Ware nicht direkt begutachten können, muss notfalls die Ware beim Endkundenuntersuchen
- Folgen
- Nachbesserung/Nachlieferung §439 I
- Rücktritt §§ 440, 437 Nr. 2, 323, 326
- Gegenseitiger Vertrag
- Pflichtverletzung ( Nichtleistung)
- Fällige, durchsetzbare, Einredefreie Leistungspflicht
- unmögliche Leistung bzw. Nacherfüllung (§ 275) → § 326 V
- Nichtleistung
- Erheblichkeit §323 V
- Fristablauf
- §323 II Entbehrlich wenn : Die Leistung enrsthaft und endgültig verweigert wird
- ERKLÄRUNG DES RÜCKTRITTS §349
- Minderung §§ 441, 437 Nr. 2
- Siehe Rücktrittsschema, ohne Erheblichkeit
- Berechnung der Minderung
- Abzustellen ist auf den objektiven Wert
- beim 'kleinen SE' ist dagegen nur die Differenz zu bilden
- Minderungspreis (Wert der mangelhaften Sache/ Wert der mangelfreien Sache) * Kaufpreis
- § 437 Nr. 3: Schadensersatz §§ 440, 280, 281, 283, 311a oder § 284
Bewerte diese Mindmap:
Deine Bewertung: {{hasRated}} / 10