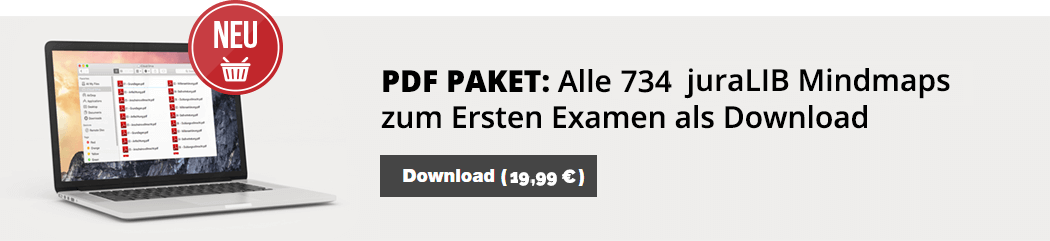17771
- Definition
- Kundgabe eines rechtlich bedeutsamen Willens, durch die eine Regelung in Geltung versetzt wird
- Bestandteile der WE
- Äußerer/ Objektiver Tatbestand/ DAS ERKLÄRTE
- Schaffung eines Erklärungstatbestandes
- liegt dann vor, wenn sich das Verhalten des Erklärenden für einen objektiven Beobachter als die Äußerung eines Rechtsfolgewillens (sog. Rechtsbindungswille) darstelltFür die Bewertung auf regelmäßige Denk-und Verhaltensweisen abstellenausdrückliche Äußerung nicht notwendig; ausreichend ist schlüssiges Verhalten
- Lehre vom faktischen Vertragsschluss
- Danach sollen Verträge zur Daseinsvorsorge und im Massenverkehr durch sozialtypisches Verhalten zustande kommen, ohne dass es hierfür einer WE bedürfe ? übeflüssig, da Vertragsschluss durch konkludentes Verhalten (vom BGH abgelehnt)
Innerer/ Subjektiver Tatbestand/ DAS GEWOLLTE- Handlungswille
- Wille, überhaupt zu handeln
- Notwendiger Bestandteil einer WE - Ohne Handlungswille keine WE
- Wann nicht gegeben?
- Bewusstlosigkeit, Hypnose, Schlaf, Reflexbewegungen, unmittelbarer Gewalt
- Rechtsfolge
- Nichtigkeit der WE (§ 105 II BGB analog)
- Erklärungswille
- Wille, etwas rechtlich Erhebliches zu erklären
- Notwendiger Bestandteil einer WE? / Welche Rechtfolge bei Fehlendem Erklärungwillen?
- Willenstheorie
- Erklärungsbewusstsein wesentlicher Bestandteil der WE
- Nichtigkeit, , § 118 analog (Erst- Recht - Schluss)
- § 122 BGB analog
- Argumente dagegen: vernachlässigt den Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes; dem Erklärenden, nicht dem Erklärungsempfänger soll das 'Erklärungsrisiko' aufgebürdet werden
- Erklärungstheorie
- Erklärungsbewusstsein kein wesentlicher Bestandteil der WE
- 2 Voraussetzungen dennoch zu erfüllen
- 1. Erkärender musste erkennen, dass sein Verhalten als WE zu deuten ist
- 2. Empfänger muss schutzwürdig sein
- Anfechtung, § 119 I Alt. 2 BGB analog
- Wenn eine WE beim Vorliegen eines Erklärungsirrtums , also bei mangelhaftem Geschäftswillen , durch Anfechtung vernichtet werden kann, muss diese Möglichkeit auch bei der Zurechnung eines nicht rechtsgeschäftlichen Handelns als WE bestehen
Wann nicht gegeben?- Verwechslung, Irrtum
Geschäftswille- Wille, eine ganz bestimmte Rechtsfolge ('konkret Rechtliches') herbeizuführen
- Kein notwendiger Bestandteil einer WE
- Rechtsfolge bei Fehlen
- zunächst Wirksamkeit der WE, da kein wesentlicher Bestandteil;
- Anfechtung § 119 I BGB
Wirksamwerden der Willenserklärung- Generelle Voraussetzungen
- Abgabe
- Problem des AbhandenkommensWillentliche Entäußerung in den RechtsverkehrProblem der Änderung des Willens vor ZugangZugang
- Problem von mündlichen ErklärungenProblem der Zugangesetzliche SchuldverhältnisseereitelungEintritt in den Machtbereich des Empfängers, sodass unter gewöhnlichen Umständen mit der KEnntnisnahme des Adressaten zu rechnen istKein Widerruf , § 130 I 2 BGBEmpfangsbedürftige WE
- Abgabe und Zugang
- Abwesende
- Anwendungsfälle
- schriftliche Korrespondenz (Brief, Telefon, Fax)
- Nachrichten auf Anrufbeantwortern
AbgabeZugang- Zugang verkörperter WE
- tatsächliche Kenntnisnahme nicht erforderlich
- Definition des Zugangs
- Machtbereich erfasst auch Empfangesetzliche Schuldverhältnisseorrichtungen
- Aushändigung muss nicht unbedingt an Empfänger selbst erfolgen
- Zeitpunkt des Zugangs bei Boten und Vetreter
- Empfangesetzliche Schuldverhältnisseertreter/ Passivvertreter, § 164 III BGB
- Empfangsbote
- der Zeitpunkt, in dem nach dem regelmäßigen Verlauf der Dinge mit der Weiterleitung an den Empfänger zu rechnen ist
- Person muss für die Inempfangnahme als geeignet erscheinen (Familienangehörige, Hausangestellte, Partner,..); regelmäßiger Kontakt zum Machtbereich des Empfängers; aufgrund ihrer Reife und Fähigkeit geeignet erscheint, Erklärungen an EE weiterzuleiten
- Bote als personifizierte Empfangseinrichtung
- Erklärungsbote
- Personen, die nach der Verkehrsauffassung nicht als Empfangsbote anzusehen sind
- wird dem Erklärenden zugerechnet; dieser muss das Risiko der rechtzeitigen und richtigen Übermittlung tragen, da WE erst bei tatsächlicher Weiterleitung dem EE zugeht
- ggü. nicht voll Geschäftsfähigen
- § 131 I BGB (Geschäftsunfähige)
- § 131 II BGB (beschränkt Geschäftsfähige)
- lediglich rechtlich vorteilhaft
- WE geht MJ selbst wirksam zu
- nicht lediglich rechtlich vorteilhaft
- Zugang erst bei Einwilligung des Vertreters
- Sodass § 108 nicht leerläuft lässt der BGH auch die Genehmigugn des Zugangs zu
- Zugangesetzliche Schuldverhältnisseereitelung
- WE gelangt aufgrund von Hindernissen aus der Sphäre des Empfängers garnicht erst in dessen Machtbereich
- Fahrlässige ZV
- zB versehentliche Nichtmitteilung einer neuen Adresse nach Umzug
- Zugang erst dann +, wenn tatsächlich erfolgt; Zugang muss also nachgeholt werden
- Empfänger muss sich bzgl. des ZP des Zugangs dann aber nach § 242 BGB so behandeln lassen, alswäre Zugang schon im ZP der Zugangesetzliche Schuldverhältnisseereitelung erfolgt
- Arglistige ZV
- zB absichtliches Nicht- Abholen eines Einschreibens trotz Benachrichtigung
- Wahlrecht des Erklärenden, ob er die Erklärung gelten lassen will
- Berufung des Empfängers auf Verspätung wäre rechtsmissbräuchlich, § 242 (keine erneute Zusendung erforderlich
- Zugang nicht verkörperter (mündliche) WE
- Mittelspersonen möglich
- Kein wirksamer Zugang ist gegeben, wenn der Erklärende erkennen musste, dass der Bote zur Weiterleitung erkennbar ungeeignet oder nach der Verkehrsanschuung nicht ermächtigt war
Anwesende- Anwendungsfälle
- mündliche Kommunikation unter physisch AnwesendenKommunikation per TelefonVideokonferenzenAbgabeZugang
- Gesetz schweigt, deshalb § 130 I S. 1 BGB analog
- Zugang verkörperter WE
- Aushändigung und Übergabe, sodass der Empfänger in die Lage versetzt wird, vom Inhalt der Erklärung Kenntnis zu nehmen
- Zugang nicht verkörperter WE
- reine Vernehmungstheorie
- Zugang erst dann +, wenn die Erklärung tatsächlich vom Empfänger akustisch richtig verstanden worden ist
- Übermittlungsrisiko beim Erklärenden
- Argument dagegen: Keine angemessene Risikoverteilung, Übermittlungsrisiko allein beim Erklärenden (Interesse des Verkehrsschutzes außer Acht gelassen)
- eingeschränkte Vernehmungstheorie
Probleme iRd Abgabe- Abhanden gekommene WE
- WE gelangt ohne den Willen des Erklärenden in den Rechtsverkehr
- Abgabe einer WE (-), da keine willentliche Entäußerung in den Rechtsverkehr
- Schadensersatz aus § 311 II iVm § 280 I (c.i.c.) nur dann, wenn Verhalten des Erklärenden objektiv sorgfaltswidrig war
- Hätte der Erklärende das Abhandenkommen vermeiden können, ist die WE wirksam, aber anfechtbar
- Änderung des Willens vor Zugang
- unbeachtlich, aber Möglichkeit des Widerrufs, § 130 I S. 2
- Rechtsgedanke des § 130 II BGB, § 116 S. 1
Probleme iRd ZugangsNicht empfangsbedürftige WE- Abgabe (also sobald der Wille erkennbar geäußert ist)Fehlender Rechtsbindungswille/ Fallgruppen
- invitatio ad offerendum
- Erklärender will nicht selbst ein Angebot machen, sondern nur zum Angebot durch Empfänger anregenBeispiele
- Ausstellung von Waren in Schaufenster
- Speisekarten
- Zeitungsinserate
Grund des fehlenden RBW- Erklärendem kommt es auf die Person des Vertragspartners an: Gefahr fehlender Zahlungsfähigkeit
- Erklärender möchte nicht eine unbestimmte Anzahl von Verträgen schließen, denn SE- Pflicht
Gefälligkeitsverhältnisse des täglichen Lebens- Abgrenzung Gefälligkeitsverhältnis - Gefälligkeitsvertrag (Rechtsgeschäft)
- objektives Verhalten maßgeblich , dabei alle Umstände des Einzelfalles berücksichtigen ? Auslegung §§ 133, 157 BGB analog, denn es geht um das Ob der WE, nicht das Wie
- Indizien der Rspr.
- Art, Grund und Zweck der Gefälligkeit
- wirtschaftliche und rechtliche Bedeutung für den Empfänger
- Interessenlage der Parteien
- Wert einer anvertrauten Sache
- erkennbares Interesse des Begünstigten
- die dem Leistenden erkennbare Gefahr, in die die andere Partei durch fehlerhafte Leistung geraten kann
- Kein RBW bei Gefälligkeiten des täglichen Lebens, sowie Gefälligkeiten die im gesellschaftlichen Verkehr wurzeln
Scheingeschäft, § 117 ISpontane Erklärungen über die Anerkennung einer Schuld- Kann verschiedene Inhalte haben
- 1. Zuerst prüfen: Abstraktes/ Konstitutives Schuldanerkenntnis, §§ 780, 781 BGB
- Eine neue, vom ursprünglichen Schuldgrund unabhängige , selbstständige Verbindlichkeit wird begründet
- kondizierbar aufgrund Selbständigkeit, § 812 II BGB
- nur wirksam, wenn schriftlich erteilt
- Ausnahme: Erteilung durch Kaufmann, § 350 HGBstrenge Voraussetzungen; selten anzunehmen, da entsprechender RBW idR fehlt2. Folgeprüfung: Deklaratorisches/ Feststellendes Schuldanerkenntnis
- Bereits bestehende Schuld wird bestätigt; keine neue VerbindlichkeitFolge: Schuldner mit allen Einreden und Einwendungen ausgeschlossenes entsteht kein neuer Schuldgrundformlos gültig und nicht kondizierbarZwischen Parteien Streit oder subjektive Ungewissheit über das Bestehen der Schuld; Parteien wollen sich durch dieses Anerkenntnis dem Streit oder der Ungewissheit entziehen und einigenErteilung von Auskünften und Ratschlägen
- Wertung des § 675 II BGB maßgeblich
- in der Regel liegt kein RBW vor
- idR nur Haftung aus Delikt
- Ausnahmen
- spezielles Beratungs- oder Auskunftsverhältnis
- RBW der Beteiligten muss die Eingehung einer derartigen Verpfichtung umfassen
- bei dauernden Geschäftsbeziehungen vermutet
- unproblematisch gegeben bei ausdrücklichem Beratungs- oder Auskunftsvertrag
- konkludenter Vertragsschluss , wenn Auskunft erkennbar bedeutend ist (Haftung wo man soll,nicht wo man will !), aber nicht, wenn Erklärender mit Haftung nicht zu rechnen braucht
Bewerte diese Mindmap:
{{percent}}% Deine Bewertung: {{hasRated}} / 10Tags:
#Voraussetzungen # Prüfung # Rechtsfolgen # Anspruch # Schema # Studium # Mindmap # Übersicht # Aufbau # Prüfungsschema # Skript # Kommentar #Jura