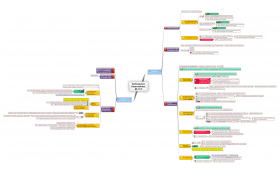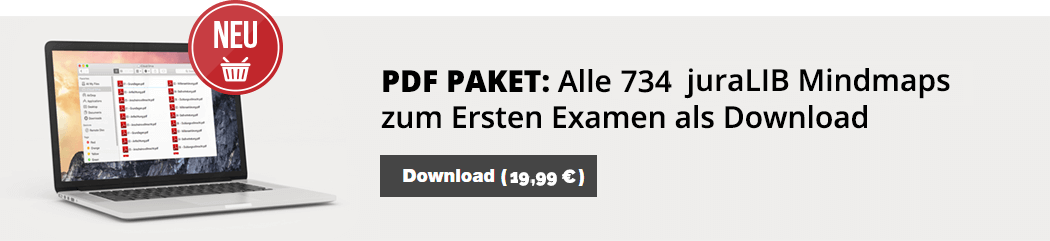- Verbraucher, Unternehmer, §§ 13 f. BGB
Käufer ist
Verbraucher, § 13 BGB (gesetzl. Regelfall)
natürliche Person
Betrachtung immer personenbezogen
(P) Zusammenschlüsse
natürlicher Personen
ja, Verbraucher
Arg.: Teilrechtsfähigkeit führt nicht zur jur. Person
Arg.: bloßer nichtkommerzieller Zusammenschluss
lässt Schutzwürdigkeit nicht entfallen
Nicht rechtsfähige Rechts-
gemeinschaft (§§ 741 ff. BGB )
ja, Verbraucher
Arg.: bloßer nichtkommerzieller Zusammenschluss
lässt Schutzwürdigkeit nicht entfallen
Erbengemeinschaft
ja, Verbraucher
Arg.: bloßer nichtkommerzieller Zusammenschluss
lässt Schutzwürdigkeit nicht entfallen
(P) juristische Personen
e. A.: Verbraucher (+), wenn keine wirtschaftliche Tätigkeit,
wenige Mitgliederundkein organisatorischer APparat
Arg.: bloßer nichtkommerzieller Zusammenschluss
lässt Schutzwürdigkeit nicht entfallen
h.M.: Verbraucher (-)
Arg.: ausdrücklicher Wortlaut
Abschluss eines
Rechtsgeschäfts
Grds.: Konkret-funktional Bestimmung anhand Zwecksetzung bei konkretem RG
nach 344 HGB auch branchenfremd
Ausnahmen
h.M.: Entscheidend = Zweckrichtung aus Unterneh-
mersicht bei hypothetischem RG-Abschluss
private
Zwecksetzung
Im Zweifel ist man Verbraucher
negative Formulierung in § 13 BGB
Zweck, der weder der gewerblichen ( § 1 HGB), noch selbständigen (§ 84 I S.2 HGB) beruflichen Tätigkeit dient
- dann Auslegung über Inhalt und Begleitumstände des Rechtsgeschäfts
Unternehmer gibt sich durch tatsächl. Hinweise/AGB als Verbraucher aus
Unternehmereigenschaft ist zwar grunds. objektiv zu bestimmen
Arg.: Anfechtungsmöglichkeit nach § 123 BGB bietet
keinen ausreichenden Schutz
Arg.: Grundsatz 'venire contra factum propium'
a.A.: Verbraucher (+)
Arg.: Eigenschaft ist grunds. objektiv zu bestimmen und nicht vertraglich disponibel
Andere Bestimmungen sind wirkungslos
(P) Bestimmung des
mit dem Geschäft
verfolgten Zwecks
a.A.: nach obj. Empfängerhorizont
Con.: Verbraucherschutz würde faktisch dispositiv
e.A.: keine Berufung auf Verbrauchereigenschaft, wenn zurechenbarer
Rechtsschein der Unternehmereigenschaft gesetzt wurde
Con.: Verbraucherschuz würde faktisch dispositiv
e.A.: allein nach Intention der Partei
BGH: offengelassen, aber Beweislast bzgl. Zweck trägt Verbraucher
doppelter Nutzungs-
zweck, dual use
Geschäfte für berufliche und private Zwecke
ab 14.06.2014 gesetzlich geregelt: es kommt auf den Schwerpunkt an
- vgl. Wortlaut 'überwiegend'
alter
Meinungsstreit
e.A.: ja, wenn nicht eindeutig und ausschließlich unternehmerische Tätigkeit
Beweislastregel § 13 BGB
a.A.: nein, es sei denn Verbrauchereigenschaft überwiegt eindeutig
e. A.: Übertragung der EuGH-Entscheidung für Zivilprozessrecht, Verbraucher (-),
wenn nicht völlig vernachlässsigbare berufliche Mitveranlassung
Bereits rationale Entscheidungsfindung,
daher nicht schutzwürdig
und h.M. (Dtl.): Schwerpunkt der Nutzung; i. Zw. nein
§ 344 I HGB analog (h.M.)
Existenzgründer
Geschäfte zum Aufbau der selbständigen beruflichen Existenz
h.M.: Verbraucher (-)
Umkehrschluss aus § 512 BGB
wenn er Verbaucher wäre, müsste man nicht An-
wenbarkeit für best. Fälle (< 75 000 ?) anordnen
Bereits rationale, wohl informierte Entscheidungsfindung
a.A.: Verbraucher (+)
Arg.: idR unerfahrenunddaher schutzwürdig
GmbH Ge-
schäftsführer
e.A.: nein
Arg.: Geschäftsführer der GmbH ist geschäftserfahren
con.: darauf kommt es nicht an, sonst wären Privatgeschäfte des GF ja auch erfasst
ja
Arg.: Unternehmer erfordert Initiative + Risiko
BAG, Deutsches Recht:
Verbraucher (+)
Arg.: AN ist klassisch unselbständig Handelnder und
sogar noch schutzwürdiger als ein 'Nur-Verbraucher'
Unionsrecht: Verbraucher (-)
Arg.: Wortsinn: AN verbraucht nichts
Verkäufer ist
Unternehmer, § 14 BGB
natürliche / juristische
Person / rechtsfähige
Personengesellschaft
Abschluss eines
Rechtsgeschäfts
siehe rechts
gewerbliche /
selbständige
Zwecksetzung
nur hobbymäßige
oder keinerlei
Gewinnerzielung
BGH: ja,
reicht aus
Arg.: Begriff hier EuropR. geprägt, nicht zwingend wie deutscher Kaufmannsbegriff
Arg.: keine Erkennbarkeit für Verbraucher, kein Privilegierungsbedürfnis
Agentur-
geschäft
Autohändler verkauft als Stellvertreter des urspr.
Eigentümers unter Ausschluss v. Mängelrechten
(+)
Wortlaut von § 474 BGB erfordert keine prof. Verkäufereigenschaft, sondern nur Handeln in Ausübung der gewerb./selbst. Tätigkeit
Lit.: (-)
sonst Verschl. der Beweisl.verteilung zu Lasten des als Privatmann hand. Untern.
bei GmbH bes. verfehlt, da keine priv. Sphäre
§ 474 bezweckt anders als HGB Ausgleich vermut. wirtsch. Ungleichheit
(P) Arbeitnehmer als Anbieter im
Rahmen der selbst. berufl. Tätigkeit
Deutsches Recht: Verbraucher (+)
Unionsrecht: Verbraucher (-)
Arg.: Selbstständigkeit nicht entscheidend
Lösung: unionsrechtskonforme Auslegung des
Unternehmerbegriffs auf alle beruflich Tätigen
Bewerte diese Mindmap:
{{percent}}% Deine Bewertung: {{hasRated}} / 10Tags:
#Voraussetzungen # Prüfung # Rechtsfolgen # Anspruch # Schema # Studium # Mindmap # Übersicht # Aufbau # Prüfungsschema # Skript # Kommentar #Jura