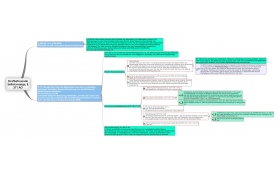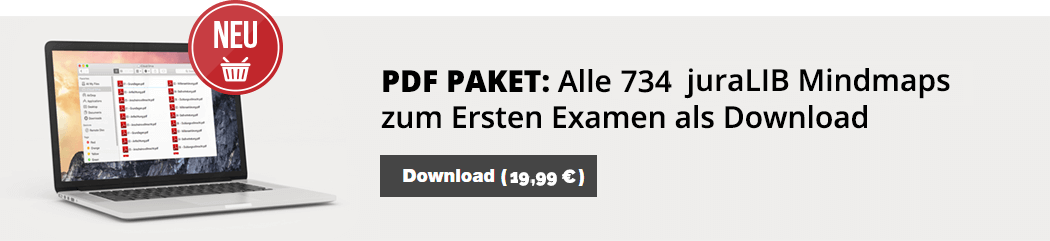- Strafbefreiende Selbstanzeige, § 371 AO
§ 369 AO i.V.m. § 24 StGB
Rücktritt von der versuchten Steuerhinterziehung
§ 24 StGB unterscheidet zwischen dem Rücktritt vom beendeten und unbeendeten Versuch. Die
Anforderungen an das Täterverhalten richten sich danach, ob der Versuch schon beendet, der
Täter also alles getan hat, was nach seiner Vorstellung von der Tat zur Verwirklichung des Tatbestandes
erforderlich ist. Steuerstrafrecht ist der beendete Versuch ??? durch Abgabe der Steuererklärung
- der Regelfall. Der Täter muss die Erfolgesetzliche Schuldverhältnisseerhinderung also mit Gegenaktivitäten herbeiführen,
indem er die Erklärung bzw. die Anmeldung berichtigt. § 24 StGB gewährt Straffreiheit
nur, wenn der Rücktritt freiwillig war
§ 371 AO gibt dem Täter die Möglichkeit, nach einer vollendeten
und sogar beendeten Steuerhinterziehung eine strafbefreiende
Selbstanzeige abzugeben.
Er ist nicht nur auf die
vollendete Steuerhinterziehung anwendbar, sondern der Täter kann
von ihm auch bei versuchter Steuerhinterziehung Gebrauch machen.
§ 371 AO tritt dann in Konkurrenz zu § 24 StGB.
§ 371 AO ist ein persönlicher Strafaufhebungsgrund, d.h., die Selbstanzeige wirkt sich grundsätzlich
nur für den aus, der sie erstattet hat, nicht dagegen für Beteiligte, die selbst keine Selbstanzeige
erstattet haben.
Positive Voraussetzungen
Nach-Erklärung
Der Täter muss gem. § 371 Abs. 1 AO seine steuerlichen Pflichten nachträglich erfüllen. Die
Selbstanzeige verlangt also immer eine Aufklärung der Finanzbehörde, entweder durch Berichtigung
der unzutreffenden Angaben oder durch Nachholung der bisher unterlassenen Aufklärung.
Auf die Form der Erklärung kommt es dabei nicht an; selbst die kommentarlose Einreichung
einer Steuererklärung reicht aus, wenn sich aus dem Umständen ergibt, dass sie an die Stelle der
ursprünglich unzutreffenden Erklärung treten soll.
Der Täter muss die steuerlich erheblichen Tatsachen vollständig und richtig angeben, soweit er
dazu in der Lage ist. Die Erklärung muss so genau sein, dass die Finanzbehörde die Möglichkeit
hat, aufgrund der Angaben eine korrekte Steuerfestsetzung vorzunehmen.
Der BGH hingegen verneint die Strafbefreiung insgesamt unter Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung
zur Wirksamkeit einer Teilsebstanzeige. Die Finanzbehörden würden durch eine Teilanzeige
nicht in die Lage versetzt, den staatlichen Steueranspruch wegen der hinterzogenen Steuern
nachträglich vollständig durchzusetzen und damit dem Zweck der Selbstanzeige, verheimlichte
Steuerquellen zu erschließen, gerecht werden. Nur die Rückkehr zur Steuerehrlichkeit bewirke
Strafbefreiung. (BGH, wistra 1993, 66; BGH NStZ 2010, 642, 643)
Bei einer versuchten Steuerhinterziehung reicht es aus, wenn der Täter die Nach-Erklärung
abgibt, da er keine Steuern verkürzt hat.
Ist die Steuerhinterziehung jedoch vollendet, muss der Täter die Steuern, die er zu seinen Gunsten
hinterzogen hat, innerhalb der ihm bestimmten ??? angemessenen - Frist nachzahlen. Diese
Pflicht entfällt nur, wenn trotz einer Steuerverkürzung kein Steuerausfall beim Steuergläubiger
eingetreten ist.
Die Ausschlusstatbestände des § 371 Abs. 1 AO
1. Bekanntgabe Prüfungsanordnung, § 371 II Nr. 1a AO
Bekanntgabe der Prüfungsanordnung als Verwaltungsakt
Bekanntgabe Strafverfahren, § 371 II Nr. 1b AO
Eingeleitet ist das Strafverfahren wegen einer Steuerstraftat nach § 397 Abs. 1 AO, sobald
die Finanzbehörde, die Polizei, die Staatsanwaltschaft, einer ihrer Ermittlungspersonen
oder der Strafrichter eine Maßnahme trifft, die erkennbar darauf abzielt, gegen jemanden we-
gen einer Steuerstraftat strafrechtlich vorzugehen. Für die Einleitung des Bußgeldverfahrens
gilt § 397 AO gemäß § 410 Abs. 1 Nr. 6 AO entsprechend.
Bekanntgegeben ist die Einleitung des Strafverfahrens, wenn dem Täter oder seinem Vertreter
amtlich mitgeteilt worden ist, dass die Behörde steuerstrafrechtliche Ermittlungen in Gang gesetzt
hat.
Erscheinen eines Amtsträgers, Nr. 1 c
(sog. ???Fußmattentheorie???)
Die Sperrwirkung ist durch den Auftrag der Prüfung begrenzt
Tatentdeckung, § 371 II Nr. 2 AO
Der Ausschlusstatbestand der Nr. 2 erfordert objektiv, dass die Tat bereits entdeckt ist und subjektiv,
dass der Täter dies weiß oder damit rechnet. Damit wird klargestellt, dass die Selbstanzeige
nicht ausgeschlossen ist, wenn der Täter irrtümlich annimmt, die Tat sei bereits entdeckt.
Tatentdeckung setzt voraus, dass durch die Kenntnis der betreffenden Person von der Tat
eine Lage geschaffen wird, nach der bei vorläufiger Tatbewertung eine Verurteilung des
Beschuldigten wahrscheinlich ist.
Die Tat muss nämlich als Straftat entdeckt
sein.
Verkürzungserfolg oder Wert des Steuervorteils über 50.000 ?, § 371 II Nr. 3 AO iVm
§ 398a AO
Die Fremdanzeige § 371 Abs. 4 AO
§ 153 AO verpflichtet die dort genannten Personen zur nachträglichen Berichtigung
einer Erklärung, wenn sie deren Unrichtigkeit erkennen. § 371 Abs. 4 AO soll dem Verpflichteten
den Entschluss zur Nacherklärung in den Fällen erleichtern, in denen er befürchten muss,
dass die Erfüllung seiner Pflicht andere Anzeigepflichtige der Strafverfolgung aussetzt.
Bewerte diese Mindmap:
{{percent}}% Deine Bewertung: {{hasRated}} / 10Tags:
#Voraussetzungen # Prüfung # Rechtsfolgen # Anspruch # Schema # Studium # Mindmap # Übersicht # Aufbau # Prüfungsschema # Skript # Kommentar #Jura