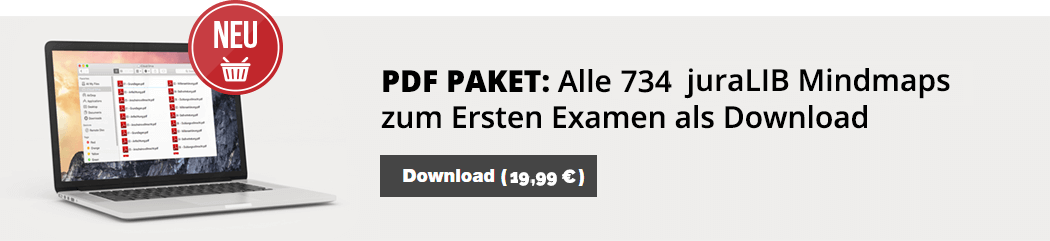Bundesgerichtshof
Entscheidung vom 16.06.1983, Az.: VII ZR 370/82 - BGHZ 87, 393
Tatbestand
Der Kläger übersandte der Firma G., mit der er in ständiger Geschäftsverbindung stand, einen auf die Beklagte (seine Bank) gezogenen Verrechnungsscheck über 20.000,- DM. Am nächsten Tag ließ er den Scheck, in dem der Tag der Ausstellung nicht eingetragen war, bei der Beklagten sperren. Ob die Firma G. von dieser Sperre Kenntnis erhielt, ist streitig.
Die Beklagte löste den ihr von der Bank der Firma G. vorgelegten Scheck irrtümlich ein. Kurze Zeit später schrieb sie den Betrag von 20.000,- DM dem Girokonto des Klägers wieder gut. Als der Kläger nach einigen Monaten seine bei der Beklagten unterhaltenen Konten auflöste und Auszahlung eines Sparguthabens verlangte, rechnete die Beklagte mit einem Bereicherungsanspruch in Höhe von 20.000,- DM auf. Sie wies darauf hin, daß der Kläger in dieser Höhe durch die Scheckzahlung zu ihren Lasten von einer Verbindlichkeit gegenüber der Firma G. befreit worden sei.
Mit der Klage verlangt der Kläger Zahlung von 20.000,- DM nebst Zinsen. Das Landgericht hat die Klage abgewiesen, das Oberlandesgericht hat ihr stattgegeben. Mit der - zugelassenen - Revision, um deren Zurückweisung der Kläger bittet, erstrebt die Beklagte die Wiederherstellung des landgerichtlichen Urteils.
I.Das Berufungsgericht deutet den undatierten und damit nach Art. 1 Nr. 5 i.V.m. Art. 2 ScheckG ungültigen Scheck in eine doppelte Ermächtigung um, die entsprechend einer Anweisung zu behandeln sei. Dies läßt keinen Rechtsfehler erkennen und wird von der Revision auch nicht angegriffen.
Entscheidungsgründe
II.Das Berufungsgericht ist der Auffassung, bei einer Leistung kraft Anweisung vollziehe sich ein etwaiger Bereicherungsausgleich grundsätzlich innerhalb der jeweiligen Leistungsverhältnisse. Die bereicherungsrechtliche Rückabwicklung sei also entweder innerhalb des zwischen den Parteien bestehenden Deckungsverhältnisses oder innerhalb des zwischen dem Kläger und der Firma G. bestehenden Valutaverhältnisses vorzunehmen. Löse die Bank trotz wirksamen Widerrufs einen Scheck ein, habe sie keinen unmittelbaren Bereicherungsanspruch gegen den Scheckempfänger, weil es sich lediglich um einen Mangel im Deckungsverhältnis handle. Sei dem Anweisungsempfänger allerdings vor Erhalt des angewiesenen Betrags der Widerruf bekannt gewesen, könne die Bank unmittelbar von ihm Rückzahlung aus ungerechtfertigter Bereicherung verlangen. In diesem Fall verdiene der Empfänger keinen Vertrauensschutz, denn er wisse, daß die Leistung der Bank nicht "als solche" seines Geschäftspartners - des Anweisenden - aufgefaßt werden könne. Die Beklagte habe aufgrund der Scheckeinlösung deshalb nur dann einen aufrechenbaren Bereicherungsanspruch gegen den Kläger, wenn die Firma G. den Widerruf nicht gekannt habe und die Leistung der Beklagten somit nicht als Leistung an die Firma G., sondern als Leistung an den Kläger anzusehen wäre. Für die Tatsache, daß die Firma G. von dem Widerruf nichts gewußt habe und der Beklagten somit kein Bereicherungsanspruch gegen sie zustehe, sei die Beklagte beweispflichtig. Diesen Beweis habe sie nicht erbracht.
Dagegen wendet sich die Revision im Ergebnis mit Erfolg.
1.Das Berufungsgericht geht zutreffend davon aus, daß sich der Bereicherungsausgleich in Fällen der Leistung kraft Anweisung grundsätzlich innerhalb des jeweiligen Leistungsverhältnisses vollzieht. Nach dem bereicherungsrechtlichen Leistungsbegriff bewirkt der Angewiesene, der von ihm getroffenen, allseits richtig verstandenen Zweckbestimmung entsprechend, mit seiner Zuwendung an den Anweisungsempfänger zunächst eine eigene Leistung an den Anweisenden und zugleich eine Leistung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger (vgl. Senatsurteile BGHZ 40, 272, 277; 61, 289, 291 m.w.N.; 66, 362, 363). Bei Fehlern im sogenannten Deckungsverhältnis zwischen dem Anweisenden und dem Angewiesenen ist der Bereicherungsausgleich also in diesem Verhältnis vorzunehmen. Weist dagegen das sogenannte Valutaverhältnis zwischen dem Anweisenden und dem Anweisungsempfänger Fehler auf, ist der Ausgleich der Bereicherung in diesem Verhältnis abzuwickeln.
Allerdings hat der Senat wiederholt zum Ausdruck gebracht, daß sich bei der bereicherungsrechtlichen Behandlung von Vorgängen, an denen mehr als zwei Personen beteiligt sind, jede schematische Lösung verbietet. Es kommt stets auf die Besonderheiten des Einzelfalles an (vgl. BGHZ 50, 227, 229 [BGH 27.05.1968 - AnwSt R 8/67]; 58, 184, 187; 61, 289, 292; 66, 362, 364; 66, 372, 374; 67, 75, 77).
So hat der Senat in einem Fall, in dem eine Anweisung zunächst wirksam erteilt und dem Empfänger durch Übergabe eines Schecks bekannt gemacht, dann aber noch vor Gutschrift oder Auszahlung ohne Kenntnis des Empfängers widerrufen worden war, entschieden, daß die Bank, die den Scheck gleichwohl eingelöst hat, keinen unmittelbaren Bereicherungsanspruch gegen den Scheckinhaber hat, sondern einen etwaigen Bereicherungsausgleich bei ihrem Kunden suchen muß (BGHZ 61, 289).
Dagegen hat der Senat in einem Fall, in dem die Bank - wie dem Einreicher bekannt war - vom Aussteller nicht unterschriebene und damit ungültige Schecks eingelöst hatte, angenommen, daß die Bank den von ihr irrtümlich gezahlten Betrag unmittelbar vom Empfänger zurückverlangen kann (BGHZ 66, 362). Denn in diesem Fall fehlte es, wie der Scheckinhaber wußte, von vornherein an einer gültigen Anweisung. Die Zahlung der Bank an den Empfänger konnte dem Kunden der Bank deshalb nicht als seine Leistung an den Empfänger zugerechnet werden. Ebenso hat der Senat in einem anderen Fall, in dem die Bank entgegen der ihr erteilten Anweisung ihres Kunden Geld an den falschen Empfänger überwiesen hatte, wie dieser wußte, die Bereicherungsklage der Bank gegen den Zahlungsempfänger durchgreifen lassen (BGHZ 66, 372).
Schließlich hat der Senat in einem Fall, in dem ein Wechselinhaber bei Empfang der Zahlung auf den Wechsel Kenntnis von der Eröffnung des Konkurses über das Vermögen des Wechselbezogenen hatte, entschieden, daß die den Wechsel einlösende Bank einen unmittelbaren Bereicherungsanspruch gegen den Zahlungsempfänger hat (BGHZ 67, 75). Dabei war für den Senat ausschlaggebend, daß der Zahlungsempfänger, der seine noch offene Forderung gegen den Bezogenen unter Einschluß der Wechselsumme bereits beim Konkursgericht angemeldet hatte, wußte, daß er die von der Bank stammende Zahlung aufgrund einer unwirksamen Anweisung erhielt. Das rechtfertigte es, die Zuwendung des vermeintlich Angewiesenen dem vermeintlich Anweisenden nicht als Leistung zuzurechnen (a.a.O. S. 78 f).
2.An dieser Rechtsprechung hält der Senat fest und führt sie dahin weiter, daß eine Bank, die irrtümlich aufgrund einer widerrufenen Anweisung eine Zahlung leistet, dann einen unmittelbaren Bereicherungsanspruch gegen den Zahlungsempfänger hat, wenn dieser bei Empfang der Zahlung denWiderruf der Anweisung kannte.
a)Mit Erteilung der Anweisung trifft der Anweisende die sein Leistungsverhältnis mit dem Dritten, dem Zahlungsempfänger, betreffende Zweckbestimmung. Danach soll der Angewiesene eine Leistung an den Anweisenden erbringen, die zugleich eine Leistung des Anweisenden an den Anweisungsempfänger darstellt. Die für einen eventuellen Bereicherungsausgleich maßgebenden Leistungsbeziehungen sind damit in dem durch die Anweisung begründeten Dreiecksverhältnis nach dem ursprünglich übereinstimmenden Willen aller Beteiligten festgelegt.
Daran ändert sich nichts, wenn der Anweisende die Anweisung nur der angewiesenen Bank gegenüber widerruft, also allein ihr gegenüber zum Ausdruck bringt, daß er eine durch sie zu bewirkende, zu seinen Lasten gehende Zuwendung an den Dritten nicht mehr wünscht. Zahlt die Bank trotzdem, weil der Widerruf übersehen wird, so will sie damit gleichwohl lediglich eine Leistung an ihren Kunden, den Anweisenden, erbringen. Der Empfänger, auf dessen Sicht es ankommt, faßt das aufgrund der vom Aussteller mit der Anweisung getroffenen Zweckbestimmung auch so auf. Vorgänge innerhalb des Deckungsverhältnisses zwischen seinem Vertragspartner und dessen Bank brauchen ihn nicht zu kümmern. Der der Bank durch die Nichtbeachtung des Widerrufs unterlaufene Fehler "wurzelt" im Rechtsverhältnis zwischen der Bank und ihrem Kunden. Die Bank darf bei einem wirksam erklärten Widerruf die von ihrem Kunden erteilte Anweisung zwar nicht befolgen. Die Gründe hierfür liegen aber allein in den zwischen der Bank und ihrem Kunden bestehenden Rechtsbeziehungen; innerhalb dieser Rechtsbeziehungen sind die Fehler grundsätzlich auch zu bereinigen (BGHZ 61, 289, 293 f).
b)Ist dem Dritten dagegen der Widerruf der Anweisung bekannt, weiß er, daß er eine eventuelle Zahlung von der Bank aufgrund eines übersehenen Widerrufs erhält. Er weiß, daß eine wirksame Anweisung für die Zahlung der Bank an ihn fehlt, weil die Bank aufgrund des Widerrufs die Anweisung nicht mehr befolgen darf. Dieser Mangel der Anweisung bleibt ihm bei Empfang des Geldes nicht verborgen. Die Zahlung der Bank an ihn stellt sich deshalb für ihn - aus seiner Sicht als Empfänger - nicht als Leistung des Anweisenden dar. Sie kann dem Anweisenden - abweichend von dem sonst geltenden Grundsatz - daher nicht als seine Leistung an den Empfänger des Geldes zugerechnet werden.
Ob die irrtümliche Zahlung der Bank eine Leistung der Bank an den Empfänger ist oder ob eine Bereicherung des Empfängers "in sonstiger Weise" anzunehmen ist, ist im Ergebnis belanglos. Es kann deshalb dahingestellt bleiben, ob es sich um eine "Leistungs"- oder um eine "Eingriffs"-Kondiktion handelt. Die Bank hat jedenfalls einen unmittelbaren Bereicherungsanspruch gegen den Empfänger (vgl. BGHZ 66, 362, 366; 66, 372, 376; 67, 75, 80; vgl. z.B. auch OLG Köln WM 1983, 190 mit zust. Anm. von Axer; Esser/Weyers, Schuldrecht BT, 5. Aufl., § 48 III 3; Koppensteiner/Kramer, Ungerechtfertigte Bereicherung, S. 47 ff; Kümpel WM 1979, 378, 381; Larenz, Schuldrecht BT, 12. Aufl., § 68 III d; Lieb in MünchKomm, BGB, § 812 Rdn. 71, 74; Udo Meyer, Der Bereicherungsausgleich in Dreiecksverhältnissen, S. 108 ff, 116; Staudinger/Lorenz, BGB, 12. Aufl., § 812 Rdn. 51; Wilhelm AcP 175, 304, 347 ff; a.A. etwa Canaris, Bankvertragsrecht, 2. Bearbeitung, Rdn. 739; derselbe WM 1980, 354, 366).
c)Dieses Ergebnis ist auch sach- und interessengerecht.
Der Kunde einer Bank hat ein schutzwertes Interesse daran, daß er durch Zuwendungen seiner Bank an Dritte nicht beeinträchtigt wird, zu denen es kommt, obwohl er eine von ihm zunächst erteilte Anweisung wirksam widerrufen hat. Übersieht die Bank einen derartigen Widerruf, muß sie deshalb das Risiko, das sich aus diesem Fehler ergibt, jedenfalls dann allein tragen, wenn der Kunde den Dritten von dem Widerruf in Kenntnis gesetzt und damit alles getan hat, um die Folgen einer irrtümlichen Zahlung von sich abzuwenden. Dann ist es gerechtfertigt, daß die Bank gezwungen ist, unmittelbar auf den Empfänger der Zahlung zuzugreifen, und zwar ohne Rücksicht darauf, ob dieser die Summe in seinem Rechtsverhältnis zum Kunden der Bank zu beanspruchen hat oder nicht. Denn der Empfänger der Zahlung verdient in diesem Falle keinen Vertrauensschutz. Er weiß, daß die Zahlung an ihn auf einem Irrtum der Bank beruht. Aus diesem Irrtum darf er keinen Vorteil ziehen.
3.Ob im Streitfall der Beklagten ein Bereicherungsanspruch gegen den Kläger zusteht, richtet sich somit danach, ob die von der Beklagten an die Firma Görz bewirkte Zahlung dem Kläger als seine Leistung zugerechnet werden kann. Dafür wiederum ist von Bedeutung, ob der Firma G. die Sperrung des Schecks, also der Widerruf der Anweisung durch den Kläger, bekannt war. Läßt sich insoweit keine Aufklärung erreichen, sind für die Entscheidung über den von der Beklagten geltend gemachten Bereicherungsanspruch die Beweislastgrundsätze maßgebend. Es kommt deshalb darauf an, welche Partei den Beweis dafür erbringen muß, daß die Firma G. von dem Widerruf des Klägers Kenntnis hatte. Entgegen der Auffassung des Berufungsgerichts ist das der Kläger.
a)Nach den allgemeinen Regeln der Beweislast hat der im Prozeß als Kläger auftretende Gläubiger die sogenannten rechts- oder klagebegründenden Tatsachen zu beweisen. Insoweit trägt er die Beweislast. Die Wirkung einer rechtsbegründenden Norm kann durch eine "rechtshindernde" Norm entkräftet sein. Für das Vorliegen "rechtshindernder" Tatsachen trägt der Schuldner die Beweislast, gegen den sich die Klage richtet (vgl. Rosenberg/Schwab, Zivilprozeßrecht, 13. Aufl., § 118 II 2 m.N.; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO, 41. Aufl., Anh. § 286 Anm. 2). Dabei ist ausschlaggebend, wer sich auf einen gesetzlichen oder von der Rechtsprechung entwickelten Regeltatbestand beruft und wer auf die Ausnahme hiervon.
b)Das bedeutet in Fällen der vorliegenden Art:
Wenn die Bank, die nach wirksamem Widerruf einer Anweisung irrtümlich an den Anweisungsempfänger gezahlt hat, sich deswegen an ihren Kunden halten will, so sucht sie den Bereicherungsausgleich in dem für sie maßgebenden Leistungsverhältnis (dem Deckungsverhältnis), in dem er grundsätzlich auch zu vollziehen ist (BGHZ 61, 289, 291 m.N.). Behauptet demgegenüber der Kunde, der Dritte habe bei Empfang der irrtümlichen Zahlung den Widerruf der Anweisung gekannt, weshalb die Zahlung ihm, dem Anweisenden, nicht als Leistung zugerechnet werden könne, so beruft er sich auf eine Ausnahme von der bei Zahlung trotz wirksam widerrufener Anweisung geltenden Regel (vgl. vorstehend Ziffer 2). Nach den Grundsätzen über die Beweislast trägt für das Vorliegen dieser Tatsache der Anweisende die Beweislast.
Daraus folgt, daß die Beklagte, die aufgrund der vom Kläger widerrufenen Anweisung irrtümlich gezahlt hat und nunmehr den Bereicherungsausgleich im Deckungsverhältnis vornehmen will, nicht beweisen muß, daß die Firma G. von dem Widerruf des Klägers nichts wußte. Vielmehr hat der Kläger, der sich wegen der von ihm behaupteten Kenntnis der Firma G. von dem Widerruf die Zahlung der Beklagten an die Firma G. nicht als seine Leistung zurechnen lassen will, den Beweis zu führen, daß der Firma G. der Widerruf bekannt war.
c)Diese Verteilung der Beweislast entspricht auch der Interessenlage.
Der Anweisende, der die Anweisung gegenüber der angewiesenen Bank widerrufen hat, kann durch Mitteilung des Widerrufs an den Anweisungsempfänger verhindern, daß eine irrtümliche Zahlung der Bank ihm als Leistung zugerechnet wird. Unterläßt er diese Mitteilung oder nimmt er sie in nicht beweisbarer Weise vor, hat er bei einer - trotz seines Widerrufs versehentlichen - Zahlung der Bank die sich daraus ergebenden (Beweislast-) Nachteile zu tragen. Wird er von der zahlenden Bank aufgrund des im Deckungsverhältnis abzuwickelnden Bereicherungsausgleichs in Anspruch genommen, ist es daher sachgerecht, wenn er die Beweislast für die Kenntnis des Widerrufs auf selten des Zahlungsempfängers trägt.
Die angewiesene Bank ist demgegenüber an dem zwischen dem Anweisenden und dem Anweisungsempfänger bestehenden Verhältnis nicht beteiligt. Sie ist regelmäßig über die Einzelheiten dieses Verhältnisses nicht unterrichtet, auch kann sie darauf keinen Einfluß nehmen. Es wäre nicht sachgerecht, die Beweislast für Vorgänge, die sich auf dieses Verhältnis beziehen oder innerhalb dieses Verhältnisses abspielen, nicht dem unmittelbar Beteiligten und damit "sachnäheren" Anweisenden, sondern der insoweit außenstehenden angewiesenen Bank aufzubürden.
III.Das Urteil des Berufungsgerichts, das von einer Beweislast der Beklagten ausgeht, kann nach alledem keinen Bestand haben. Es ist daher aufzuheben. Da das Berufungsgericht keine Feststellungen getroffen hat für den Fall, daß dem Kläger die Beweislast für die Kenntnis der Firma G. vom Widerruf der Anweisung obliegt, kann das Revisionsgericht nicht selbst entscheiden. Die Sache ist deshalb zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch über die Kosten der Revision, an das Berufungsgericht zurückzuverweisen.