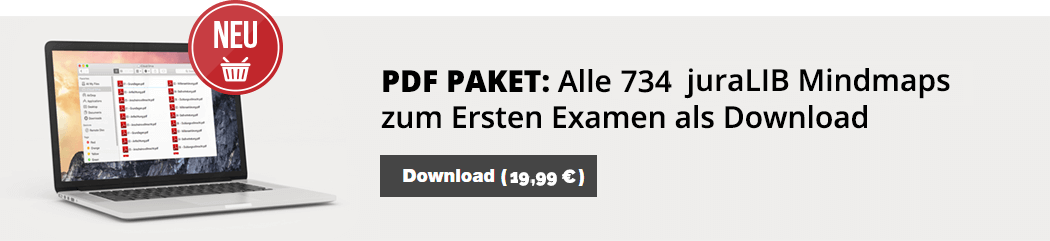13310
- Grundrechtstheorie
- Brokdorf-Entscheidung
- BeispielBedeutung
- - Funktionalisierung der Grundrechte - Organisations- und verfahrensrechtliche Dimension der Grundrechte
- Frage der Offensichtlichkeit muss erschöpfend geklärt werden und insoweit über lediglich summarische Prüfung hinausgehen
- Schwangerschaftsabbruch I-Urteil
- Zustimmungsbedürftigkeit von Gesetzen
- Grundrechtlicher Schutz ungeborenen Lebens
- Grundrechte als Schutz- und Handlungspflichten
- Herleitung: - Positivrechtliche Grundlage: Art. 1 I 2 GG - Grundrechte als objektive Werteordnung - Stärkung der Wirkungskraft der Grundrechte
- Alternative Begründungsansätze: - Schutzpflichten als notwendige Ergänzung des Gewaltmonopols - Abwehrrechtliche Rekonstruktion - Staatszweck 'Sicherheit'
- Voraussetzungen: - Schutzgut - Beeinträchtigung
- Inhalt der Schutzpflicht:
- Schutzniveau/Schutzbedarf: - Prinzip des schonenen Ausgleichs (praktische Konkordanz)/Mindestgarantie - Bedeutung der gefährdeten Rechtsgüter - Untermaßverbot
- Mittel zur Erreichung des gebotenen Schutzniveaus: - in erster Linie von Gesetzgeber zu entscheiden - Spielraum bei Beurteilung der tatsächlichen Verhältnisse, bei erforderlichen Prognosen und bei Wahl der Mittel - Untermaßverbot (angemessener Schutz, tatsächliche Wirksamkeit, sorgfältige Tatsachenermittlung und vertretbare Einschätzungen) - weiter Einschätzungs-, Wertungs- und Gestaltungsspielraum; grds. unbestimmt
- Subjektives Recht auf Erfüllung der Schutzpflicht? - Folge wäre: VB möglich, ansonsten nur abstrakte Normenkontrolle
- Pro: Schutzpflicht gerade für Einzelnen gedacht (BVerfG, aber besondere Darlegungslast)
- Contra: Überforderung des BVerfG; zu viel Entscheidungsmacht des BVerfG
- BeispielKritik
- kaum Zweifel an Schutzpflichtendimension, aber Kritik an Anwendung und Ausgestaltung: - Dogmatik zur Sicherung der Gestaltungsfreiheit des Gesetzgebers unabdingbar - Differenzierte Kontrolldichte für Abwehrrecht und Handlungspflicht - Inhalt der Pflicht: jedenfalls kein Gebot zur Bestrafung - Reduzierung der Anforderungen an Nachweis der Eignung - Schutzpflichten verwandeln Freiheitsrechte in Freiheitseingriffe
- Kontrolldichte des BVerfG (insb. Kontrolle der Geeignetheit, Bewertung von Empirie, Umgang mit Unsicherheiten bei Bewertung und Prognose von Entwicklungen)
- Wesensgehaltsgarantie (Häberle)
- Grundrechte im Ganzen der Verfassung
- - ganzheitliche Verfassungsauslegung - Grundgesetzliche Werte als positivierte Werte (Gegensatz zu Dürig) - Verfassung schützt im Grundrechtsteil Lebensgüter der Individuellen und Allgemeinheit - Geltendes Verfassungsrecht findet in geschriebener Verfassung keinen erschöpfenden Ausdruck - Soziale Funktion ist dem Recht und Grundrechten wesentliches Element - Soziale Funktion ist Absage an einseitig individual-rechtliche Sicht der Freiheit und an liberales und individualistisches Grundrechtsverständnis - Freiheit und soziale Funktion dürfen nicht alternativ ggü gestellt werden (Gleichrangigkeit) - Grundrechtsgewährleistung und -ausübung sind durch Verschränkung von öffentlichen und Individualinteressen gekennzeichnet
- Doppelcharakter der Grundrechte
- Grundrechte als Institute
- - Institute = freiheitlich geordnete und ausgestaltete Lebensbereiche - Normenkomplexe, die durch objektive Grundrechtsidee zu Einheit geformt werden - Institut = Zustand - Institute gewinnen Freiheitlichkeit durch Zuordnung subjektiver Individualrechte, sind auf schöpferische Spontanität der Individuen angewiesen, werden durch Ausübung individueller Freiheitsrechte immer wieder neu eingerichtet - gefährdet, wenn nur Minderheit Grundrecht tatsächlich in Anspruch nehmen können ('Freiheit der Vielen'
- Grundrechte als Individualrechte
- - Individualrechte = Vorgang - wegen und im Interesse der institutionellen Seite der Grundrechte dem Grundrechtsberechtigten verbürgt - Eigengesetzlichkeit der geschützten Lebensbereiche legt sich Individuen verpflichtend auf - Inhalt und Grenzen sind mit Blick auf Lebensbereiche zu bestimmen - Individualrecht nicht Freiheit zur Beliebigkeit - Einzelne besitzt in jeweiligen Lebensbereich eine Aufgabe; Bindung an Grundrechtstheorie - Individuelle Freiheit ist Freiheit im Recht
- Verhältnis Institut/Individualrecht
- - Gleichrangigkeit + Wechselbeziehung - Gegenseitige Verstärkung - Institutionelle seite ist in individualrechtlichen angelegt (nicht Umbau, nicht Folge, nicht alternativ, keine Zweck-Mittel-Relation) - beide dienen Stärkung der Freiheit - Institute brauchen individuelle Spontanität, individuelle Spontanität ist aber ohne Institute nicht vorstellbar - Einzelne besitzt in jeweiligen Lebensverhältnisse eine Aufgabe; Bindung an Grundrechtstheorie
- Rolle des Gesetzgebers
- - Ausgestaltungs- und Begrenzungsfunktion mit Blick auf beide Funktionen - Gesetzgeber verhilft Grundrechten zu dauerhafter Existenz - Gesetze zum Schutz der Institute keine Eingriffe in individualrechtliche Seite - Institute ermächtigen Gesetzgebung zu Grundrechtsbegrenzungen + sichern Grundrechte gegen Gesetzgeber - Institute sind absolut geschützt, individuelle Rechte können in Einzelfall auch vollständig entzogen werden - Missbrauch eines Rechts gehört von vornherein nicht zum Schutzgehalt (Folge: Kriminalstrafrecht gehört zum Wesensgehalt der Grundrechte)
- BeispielKritik:
- - Besitzstandswahrung - Freiheit wird in Pflicht verkehrt - Schwächung der individualrechtlichen Seite - Grundrechte werden Parlament und seinem Wertesystem anvertraut - Diktatur der Werte, Werttotalität - Kapitulation vor Faktizität - Freiheit = Recht auf Beliebigkeit
- Interpretation von Art. 19 II GG
- - aktuell deklaratorisch, latent konstitutiv - sichert Prinzipien, die bereits andernort in Verfassung zum Ausdruck kommen - auch ohne Wesensgehaltsgarantie ist für jedes Grundrecht der zu gewährleistende Wesensgehalt zu ermitteln - ausdrückliche Garantie kann aber Wirkung verstärken - dient Rechtssicherheit - hilft, wenn differenzierte Verfassungsinterpretation betrieben wird
- Sicherungesetzliche Schuldverhältnisseerwahrung II-Urteil
- Elfes-Urteil
- Problem: Was bedeutet 'freie Entfaltung der Persönlichkeit'
- BVerfG: Handlungsfreiheit im weitesten Sinne
- - Allgemeine menschliche Handlungsfreiheit - subsidiär ggü speziellen Gewährleistungen - Ergänzung der spziellen Gewährleistungen - Auffanggrundrecht
- Argumente: - Systematisch: Schranken nur bei dieser Interpretation sinnvoll - Geschichte: Herrenchiemsee-Formel 'Jeder kann tun und lassen, was er will - Systematisch: Einschränkungen hinreichend möglich ('verfassungsmäßige Ordnung')
- Persönlichkeitskerntheorie
- Problem: Was bedeutet 'verfassungsmäßige Ordnung'
- BVerfG: allgemeine Rechtsordnung
- Gesamtheit der Normen, die formell und materiell mit der Verfassung in Einklang stehen
- Argumente: - Systematisch: weiter Schutzbereich verlangt nach weiter Beschränkungsmöglichkeit (Ausweitung der Schranke ist Folge der Ausweitung des Schutzbereichs) - Systematisch: Unterschiedliche Interpretationen des Begriffs 'verfassungsmäßige Ordnung' je nach Regelungsstandort im GG ist zulässig - Geschichte: Herrenchiemsee-Entwurf -→ ausdrückliche Bezugnahme auf Möglichkeit der Einschränkung durch jede Norm - Teleologisch: kein Leerlaufen der Grundrechte zu befürchten, da insb. Werteordnung und Wesensgehaltsgarantie
- Freiheitlich-demokratische Grundordnung
- Problem: Prüfungsumfang bei Anwendung im Einzelfall
- Spezifisches Verfassungsrecht
- Hecksche Formel: Gestaltung des Verfahrens, Feststellung und Würdigung des Sachverhalts und Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts ist allein Sache der anderen Gerichte und der Überprüfung durch BVerfG entzogen
- Grenze zwischen einfachem Recht und Verfassungsrecht
- Schumannsche Formel: Verletzung spezifischen Verfassungsrechts dadurch bestimmt, dass 'der angefochtene Richterspruch eine Rechtsfolge annimmt, die der einfache Gesetzgeber nicht als Norm erlassen dürfte'
- Grenze zwischen zulässiger richterliche Rechtsfindung und -fortbildung und unzulässiger Rechtsfortbildung entscheidend
- BVerfG: Entscheidend 'ob bei Auslegung und Anwendung des einfachen Rechts der Einfluss der Grundrechte grundlegend verkannt ist'. Auslegungsfehler, da Grundrecht ganz übersehen oder Bedeutung des Grundrechts grundsätzlich unrichtig eingeschätzt und Auslegungsfehler von einigem Gewicht
- Willkür
- Eingriffsintensität
- BeispielKritik
- - Historisch/Teleologisch/Systematisch: Grundrechte sollen nur bestimmte Täigkeiten schützen - Geschichte: Herrenchiemsee-Formel wurde gerade nicht Teil des GG - Kontext der Elfes-Entscheidung spricht gegen weite Interpretation der Entscheidung - Systematisch: Subjektivierung des Rechtsstaatsprinzips von GG nicht gewollt - Teleologisch: VB wird zur allgemeinen Normenkontrolle - Teleologisch: Banalisierung und Entwertung der Grundrechte - Systematisch: Ausuferung der VB - Teleologisch: Recht auf beliebiges Handeln führt nicht zu effektivem Freiheitsgewinn
- BeispielBedeutung
- - Erkenntnis, dass sich Grundrechtsverletzung aus sonstigem Verfassungsrecht des Bundes ergeben kann - Ist VB erst einmal zulässig nimmt BVerfG umfassende Prüfungsbefugnis in Anspruch - Erkenntnis, dass Überprüfung gerichtlicher Entscheidungen durch BVerfG eine Beschränkung bedarf
- Lüth-Urteil
- Grundrechte in erster Linie Abwehrrechte gegen den Staat
- in Grundrechtsbestimmungen verkörpert sich objektive Werteordnung als verfassungsrechtliche Grundentscheidung für alle Bereiche des Rechts gilt
- Begründung der grundrechtskonformen Auslegung
- Bezugnahme auf 'Werttheorie' von Smend? - Kelsen: Staat ist Recht = reine Rechtslehre (Positivismus) - Smend: Staat ist nicht nur Recht, sondern die wahre Wirklichkeit - BVerfG: Stellt nicht auf Werte der Gesellschaft ab, sondern auf Werte der Grundrechte (Modifikation der Theorie von Smend, da Grundrechte erhalten bleiben und nicht 'schwammig' sind wie die wandelbaren Werte der Gesellschaft)
- Begründung der mittelbaren Drittwirkung
- Bezugnahme auf Konstuktionsvorschlag von Dürig? - Dürig: kommt aus Naturrecht und spricht von Zivilgerichtsbarkeit - BVerfG: kommt aus Werteordnung und spricht von Überprüfung der Entscheidung durch das BVerfG
- Rechtsgehalt der Grundrechte entfaltet sich im Zivilrecht mittelbar durch privatrechtliche Vorschriften
- Grundrechtsverletzung, wenn Einwirkung der Grundrechte auf Zivilrecht verkannt: BVerfG keine Superrevisionsinstanz
- BeispielKritik
- - Verfassung als Rahmen- nicht Werteordnung, Grundrechte als Trennlinie; Staat als formeller Rechtsstaat (Werte kommen von Gesellschaft) - Verfassung ist einmaliger einhegender Akt der Selbstbegrenzung des Souveräns, kein Prozess, kein Ziel, kein Auftrag - Rechtssicherheit und Vorhersehbarkeit gefährdet - Justizstaat; Gefährdung Gewaltenteilung - Grundrechte werden ins Gegenteil verkehrt - Vernachlässigung der abwehrrechtlichen Wirkung - Eigenwert des Privatrechts geht verloren; Koordinierung der Freiheiten der Bürger = Aufgabe des Privat-, nicht des Verfassungsrechts
- BeispielReaktion BVerfG auf Kritik
- - Einführung der Prüfung der Verhältnismäßigkeit, um Prüfung zu vereinheitlichen - Interpretation mit juristischen Methoden nicht irgendwie - begriffliche Distanzierung -→ jetzt wertentscheidende Grundsatznorm
- Rechtsgehalt der Grundrechte entfaltet sich im Zivilrecht mittelbar durch privatrechtliche Vorschriften
- Allgemeines
- DefinitionDefinitionen: - Böckenförde: Grundrechtstheorie ist 'eine systematisch orientierte Auffassung über den allgemeinen Charakter, die normative Zielrichtung und die inhaltliche Reichweite der Grundrechte - Grimm: Die juristische Grundrechtstheorie leistet die Deutung der Grundrechte; sie steckt den Rahmen ab, 'in dem die grundrechtlichen Freiheiten aktualisiert werden können' - Schmidt: Gegenstand der Grundrechtstheorie ist die Frage, 'wann und warum es überhaupt auf Grundrechte ankommt - Jestaedt: 'Grundrechtstheorie als 'Subdisziplin der Verfassungstheorie', die 'die Gesamtheit der der Grundrechtsauslegung (...) voraus liegenden Basisannahmen über Funktion und Struktur, Inhalt und Reichweite der Grundrechte, kurz das auslegungsspriorische Grundrechtsverständnis' umfasst.
- Abgrenzung: - Grundrechtsinterpretation: wechselseitiges Verhältnis - Grundrechtsdogmatik: fließender Unterschied - Staats- und Verfassungstheorie: bezieht sich auf gesamte Verfassung und nicht auf Grundrechte beschränkt
- Arten von Theorien: - Umfassende Theorie: muss drei Dimensionen der Rechtswissenschaft (empirisch, analytisch, normativ) angemessen verbinden - Kombinierte Theorie: in Theorie wird Grundansicht allgemeiner Art über Zweck und Struktur der Grundrechte ausgedrückt - Allgemeine Theorie: bezieht sich auf Grundrechte insgesamt - Partikulare Theorie: bezieht sich auf bestimmte Grundrechte
- Zweck von Grundrechtstheorien: - Rationalisierung der Interpretation - Systematisierung der Interpretationsergebnisse - Erschließen von Argumenten, Strukturierung des Argumentationsprozesses
- Grundrechtstheorie/Grundrechtsinterpretation (Böckenförde)
- Kontext
- Dürig: geschlossenes System, lückenloser Schutz, Menschenwürde als oberstes Konstruktionsprinzip
- Scheuner: Grundrechte enthalten Reihe besonderer Verbürgungen; lassen sich nicht aus allgemeinen, abstrakten Prinzip ableiten
- Häberle: Grundrechte sind objektives, einheitliches System von konstitutiver Bedeutung für Ganze der Verfassung
- BVerfG: lückenloser Schutz (Elfes); Grundrechte haben mehrere Funktionen, die eng miteinander verbunden sind und ineinander übergehen; derjenigen Auslegung gebührt Vorrang, die Wirkkraft am stärksten entfaltet; objektive Werteordnung, Wertsystem, grundrechtliches Wertsystem (Lüth)
- Plädoyer für Orientierung der Grundrechtsinterpretation an der verfassungskonformen Grundrechtstheorie
- Bedeutung der Grundrechtstheorie: Grundrechte sind Lapidarformeln und Grundsatzbestimmungen, die ausfüllenden Interpretation bedürfen
- ergibt sich aus Staats-/Verfassungstheorien
- BeispielArten von Grundrechtstheorien
- liberale (bürgerlich-rechtsstaatliche) Grundrechtstheorie: Grundrechte sind Freiheitsrechte des Einzelnen ggü dem Staat Problem: relative 'Blindheit' ggü sozialen Voraussetzungen der Realisierung grundrechtlicher Freiheit
- Institutionelle Grundrechtstheorie: Grundrechts haben Charakter objektiver Ordnungsprinzipien Problem: Sicherung des status-quo ('Versteinerung')
- Werttheorie der Grundrechte: Grundrechte haben primär den Charakter objektiver Normen, als Ausfluss der Wertgrundlage des staatlichen Gemeinwesens Problem: emanzipiert sich von herkömmlichen juristischen Methode, Einströmen ggf. rasch wechselnder Wertauffassungen und Werturteile
- Demokratisch-funktionale Grundrechtstheorie: Verständnis der Grundrechte von ihrer öffentlichen und politischen Funktion her Problem: bestimmter Freiheitsgebraucht wird privilegiert, Freiheit wird eingeschränkt, Freiheit wird zur Pflicht
- Sozialstaatliche Grundrechtstheorie: Grundrechte haben nicht nur negativ-ausgrenzenden Charakter, sondern vermitteln zugleich Leistungsansprüche an den Staat Problem: Abhängigkeit der Grundrechtsgewährleistung von staatlichen Finanzmitteln
- Welche Grundrechtstheorie ist verfassungskonform? Freiheitsprinzip des liberalen Rechtsstaats + Sozialstaatsauftrag
- Grundrechte in der Zivilrechtsprechung (Dürig)
- unmittelbare Drittwirkung
- pro: - Erst-recht-Schluss aus Art. 1 III GG - Freiheitsbedrohung durch Private - Ordnungsanspruch des GG - Vereinbarkeit von Geltung Privat/Staat und Privat/Privat - Einheit/Widerspruchsfreiheit der Rechtsordnung - Sozialstaatsprinzip: 'sozialgebundene Freiheit' - Grundrechte als absolute Werte - Art. 2 I GG: Rechte anderer
- contra: - Art. 2 I GG: Privatautonomie gefährdet - Art. 1 I GG - Art. 1 I 2 GG - Art. 1 III GG: deutliche Aussage gegen 'Drittwirkung', wenn ausdrücklich nur Staat gebunden - Art. 3 I GG: Beachtung des Willkürverbot (Vergabeverfahren bei Privaten) - Schranken/Rechtsunsicherheit: Rechte ggü Staat würden zu Pflichten ggü Mitbürgern - Entstehungsgeschichte: Abwehrrechte - Grundrechte mit ausdrücklicher Wirkung auf Private (zB Art. 9 III 2 GG)
- Lösung nach Dürig: mittelbare Drittwirkung
- - Grundrechte als absolute Werte müssen Zivilrecht beeinflussen - Private sind nicht an Grundrechte gebunden, sondern nur Zivilrichter bei Anwendung der Normen -→ Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe als 'Einbruchstellen' der Grundrechte in Bürgerliche Recht
- Intensitätsgrade: - Verdeutlichungs aufgrund des vorhandenen durchgebildeten privatrechtlichen Schutzsystems - Akzentuierung (Wertgeschärfte Auslegung) - Lückenfüllung des privatrechtlichen Schutzsystems
- Alternativvorschläge: - Nicht abwehrfähige Eingriffe durch Private = durch die öffentliche Gewalt - BVerfG: objektive Werteordnung für alle Bereiche des Rechts - Lösung über staatliche Schutzpflichten
- Theorie der Grundrechte (Alexy)
- Grundrechts im Leistungsstaat (Häberle)
- Inkurs: Georg Jellinek, System der subjektiven öffentlichen Rechte
- Status subjectionis (status passivus) - Rein passiver Status, keine Rechte, Einzelne ist 'unterworfen'
- Status negativus - Freiheit vom Staat, in dem der Einzelne individuelle Probleme ohne Staat lösen, gesellschaftliches Zusammenleben ohne Staat regeln und Geschäfte ohne Staat abwickeln kann - Grundrechte als Abwehrrechte
- Status positivus - Freiheit durch Staat (Zustand, in dem Einzelne seine Freiheit nicht ohne Staat haben kann, sondern für Schaffung und Erhaltung seiner freien Existenz auf staatliche Vorkehrungen angewiesen ist) - Grundrechte als Anspruchs-, Schutz-, Teilhabe-, Leistungs- und Verfahrensrechte
- Status activus - Zustand, in dem der Einzelne seine Freiheit im und für Staat betätigt, diesen mitgestaltet und an ihm teilnimmt - staatsbürgerliche Rechte, Recht auf Teilnahme an staatlichen Prozessen
- Neuer Knoten
Bewerte diese Mindmap:
Deine Bewertung: {{hasRated}} / 10